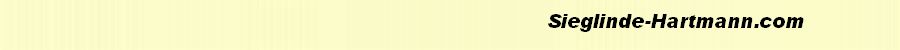Hier finden Sie ergänzende Materialien für das WS2016-2017
Hier finden Sie die Materialien zu den einzelnen Sitzungen des SS 2014:
Material zur 3. Sitzung
Material zur 4. Sitzung
Material zur 5. Sitzung
Material zur 7. Sitzung
Material zur 7. Sitzung
Material zur 8. Sitzung - Teil a
Material zur 8. Sitzung - Teil b_1
Material zur 8. Sitzung - Teil b_2
Material zur 9. Sitzung - Teil 1
Material zur 9. Sitzung - Teil 2
Aktuelle Seminarpläne
Prof. Dr. Sieglinde Hartmann –
Hauptseminar SS 2013
Oswald von
Wolkenstein (ca. 1376/77-2.8.1445)
Zeit: Montags
16.00-18.30, Ort: Phil-Geb. ÜR 24
S E M I N A R P L A
N
1) 21. Oktober - Einführung und
Themenvergabe
2) 28. Oktober – Autobiographische Lyrik:
Begriffsbestimmung, Lektüre, Übersetzung + Interpretation von Kl 18 (Sprecherrollen, Signalwörter, Dechiffrierung
der Bildsprache, Visualisierungsstrategien, Komik und Ironie)
3) 04. November – Das neue Genre der
(autobiographischen) Reiselieder (Kl 19, Kl 41 + 44) - mit Gastvortrag von Prof. Dr. Danielle Buschinger
(Amiens): Wolkensteins politische und moral-didaktischen Lieder und ihre
Bezüge zur Sangspruchdichtung
4) 11. November – Wolkensteins politische Lyrik (Kl 85, Kl
27 + 113)
5) 28. November – Wolkensteins Liebeslyrik
(1): Tagelieder (Kl 101, 48, 33)
6) 25. November – Wolkensteins Liebeslyrik
(2): Dialoglieder (Kl 43 + 79, Kl 71 + 77)
7) 02. Dezember – Wolkensteins Liebeslyrik
(3): Pastourellen und Schäferdichtung (Kl 78 +
83, Kl 92 und das ‚Kuhhorn’ des Mönchs von Salzburg)
8) 09. Dezember – Wolkensteins neuartige
Naturbilder: die autobiographischen ‚Hauensteinlieder’ (Kl 104, Kl
116) und die Frühlingslieder Kl 42 + 50
9) 16. Dezember – Weltenlust (Trinklieder Kl
54, 70, 84) und Weltverneinung (Weltabsagelieder Kl 9 + 11)
10) 13. Januar – Wolkensteins
autobiographische Lieder über seine Gefangenschaften (Kl 55, 59 + 26; Kl 1
+ 7)
11) 20. Januar – Todesfurcht in Wolkensteins
autobiographischen Liedern Kl 23 + 6 – mit Gastvortrag P. Winfried Schwab OSB, Subprior des Benediktinerstifts Admont und Präsident der österreichischen Totentanzvereinigung zum Thema: ‘Oswald von Wolkenstein und das Phänomen der Totentänze’.
12) 27. Januar – Wolkensteins geistliche Lieder:
Marienlieder
13) 01. Februar - Wolkensteins Religiosität:
Beichtlied KL 39 und Höllenlied Kl 32 - ENTFÄLLT!
Vortragszeit des mündlichen
Referats: 20-30 Minuten + 10 Minuten Diskussion; Umfang der schriftlichen
Ausarbeitung: max. 15 DinA4-Seiten + Bibliographie. – Die Interpretation
eines Liedes umfasst: Übersetzung, metrisches Schema, Einordnung in
Gattungstradition oder biographischen Kontext, Analyse von Inhalt und Form
unter dem vorgegebenen Aspekt und in Auseinandersetzung mit der
einschlägigen Sekundärliteratur; wenn möglich mit
Vorführung einer Einspielung oder eigenem Gesangsvortrag.
Achtung: die
Kenntnis der Biographie Oswalds von Wolkenstein ist Voraussetzung zur Teilnahme
am Seminar!
Textgrundlage:
Die Lieder Oswalds von Wolkenstein. Unter Mitwirkung von
Walter Weiss und Notburga Wolf hrsg. von Karl Kurt Klein. Musikanhang von Walter Salmen. Tübingen 1962, 3.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage von Hans Moser, Norbert Richard Wolf
und Notburga Wolf. Tübingen
1987 (= Altdeutsche Textbibliothek 55) =
wissenschaftliche Standardausgabe, zitiert: Kl + Liednummer.
Ohne Variantenapparat stehen alle
Texte der Klein’schen Ausgabe auf der Homepage der Oswald von
Wolkenstein-Gesellschaft kostenlos abrufbereit: http://www.wolkenstein-gesellschaft.com
Zur
Anschaffung empfohlene Teilausgabe:
Oswald von
Wolkenstein. Lieder. Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählte
Texte herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Burghart Wachinger. Melodien und Tonsätze
von Horst Brunner. Stuttgart:
Reclam Verlag 2007 (= UB 18490).
FOLGENDE
TITEL bzw. BIBLIOGRAPHISCHEN HILFSMITTEL GELTEN FÜR ALLE SITZUNGEN:
Josef SCHATZ: Sprache und Wortschatz der
Gedichte Oswalds von Wolkenstein. Wien und Leipzig 1930 (= Akademie der
Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 69,2).
Verskonkordanz zu den
Liedern Oswalds von Wolkenstein.
Hrsg. von George F. JONES, Hans-Dieter MÜCK und Ulrich MÜLLER. 2 Bde.
Göppingen 1973 (= G.A.G. 40/41).
Klaus J. SCHÖNMETZLER:
Oswald von Wolkenstein. Die Lieder mhd.-deutsch.
München 1979 [mit Rekonstruktion
aller Melodien!].
Burghart WACHINGER: Oswald von
Wolkenstein. Artikel in: Verfasserlexikon. 2. Aufl. Bd. 7. 1989. Sp. 134-169.
Werner MAROLD: Kommentar zu den
Liedern Oswalds von Wolkenstein. Hrsg. von Alan ROBERTSHAW. Innsbruck 1995 [Wichtige Erläuterungen zur Metrik!].
Anton SCHWOB: Oswald von
Wolkenstein. Eine Biographie. Bozen 1977.
Anton SCHWOB u.a. (Hrsg.): Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein,
Edition und Kommentar, 4 Bände. Wien, Köln 1999 / 2000 / 2004 / 2011
/ 2013.
Alan
ROBERTSHAW: Zur Datierung der Lieder Oswalds von Wolkenstein. In:
Rollwagenbüchlein. Fs. für W. Röll.
Hrsg. von Jürgen Jaehrling u.a.
Tübingen 2002, S. 107-135.
Ulrich
MÜLLER: "Dichtung" und "Wahrheit" in den Liedern
Oswalds von Wolkenstein: Die autobiographischen Lieder von den Reisen.
Göppingen 1968.
Sieglinde
HARTMANN: Oswald von Wolkenstein heute: Traditionen und Innovationen in seiner
Lyrik. In: JOWG Bd. 15 (2005), S. 349-372.
Johannes
SPICKER: Oswald von Wolkenstein. Die Lieder. Berlin 2007 (= Klassiker
Lektüren 10).
Sieglinde HARTMANN: Oswald von
Wolkenstein. Artikel in: Kindlers Literatur Lexikon. 3., völlig neu
bearbeitetet Auflage. Hrsg. von Heinz Ludwig ARNOLD. Stuttgart / Weimar 2009,
Band 12, S. 418-420.
Burghart
WACHINGER: Textgattungen und Musikgattungen beim Mönch von Salzburg und
bei Oswald von Wolkenstein. In: Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Berlin 2010, S.
385 – 406.
Oswald von Wolkenstein. Das
poetische Werk. Übers. von Wernfried HOFMEISTER.
Berlin u.a. 2011 [Sekundärliteratur
zu einzelnen Liedern, vor jeder Interpretation zu konsultieren!].
Ulrich MÜLLER / Margarete
SPRINGETH (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin u.a. 2011 [Forschungsbilanz mit vollständiger Bibliographie!].
Oswald von Wolkenstein im
Kontext der Liedkunst seiner Zeit. Hrsg. von Ingrid BENNEWITZ und Horst
BRUNNER: Wiesbaden 2013 (= JOWG Bd. 19).
__________________________________________________________________________
SS 2013
Prof. Dr. Sieglinde Hartmann:
Oswald von Wolkenstein und die deutsche Lyrik des Spätmittelalters
Sommersemester 2013
Wann?
Montags 16.00-18.00 Uhr Wo? Hörsaal 2
VORLESUNGSPLAN
1) 22. April 2013 – Einführung
2) 29.
April 2013 – Traditionen und Innovationen in den Liedern Oswalds von
Wolkenstein
3) 06.
Mai 2013 – Die Reisen des Ritters Oswald von Wolkenstein und seine
autobiographischen ‘Reiselieder’ Kl 18, 19 und 44
4) 13. Mai 2013 – Wolkensteins politische
Lyrik: Der Kampf um Greifenstein in Tirol (Kl 85) und Wolkensteins Beteiligung an den
Reichskreuzzügen gegen die Hussiten (Kl 27 + Kl 134)
5) 03. Juni 2013 – Wolkensteins Lebenswelt und seine neuartigen Naturbilder: Die Pastourelle Kl 83, die ‘Hauensteinlieder’ Kl 116 und Kl 104 sowie das Vogelstimmenkonzert Kl 505)
6) 10. Juni 2013 – Minnesangtradition und Innovation in Wolkensteins Liebesliedern: die Tageliedvariationen Kl 101, Kl 53, das Neujahrslied Kl 61 Gelück und hail und das Liebesduett Kl 77 “Simm Gredlin, Gret”
7) 17. Juni 2013 – Weltenlust und Weltverneinung: Carmina Burana (In taberna quando sumus) vs. Oswalds Trinklied Her wiert, uns dürstet also sere (Kl 70), Walther von der Vogelweide Fro Werlt vs. Oswalds O welt, o welt (Kl 9)
8) 24. Juni 2013 – Wolkensteins geistliche Lieder: Die neuartigen Text-Bild-Verhältnisse in Wolkensteins Marienliedern Kl 78, Kl 120 und Kl 34
9) 08. Juli 2013 – Wolkensteins Religiosität: Gefangenschaft, Folter, Todesangst und Höllenvorstellung Kl 1, Kl 6, Kl 7 und Kl 32)
Hier finden Sie
nachfolgend:
3. Kommentar
4. Sekundärliteratur (in
Auswahl der Vorlesungsthemata)
5. Diskographie
1. Textgrundlage
1.1 Standardausgabe
Die Lieder Oswalds von
Wolkenstein-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von Walter Weiss und Notburga Wolf
hrsg. von Karl Kurt Klein. Musikanhang von Walter Salmen. Tübingen 1962, 3.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage von Hans Moser, Norbert Richard Wolf und
Notburga Wolf. Tübingen 1987 u.ö. (= Altdeutsche Textbibliothek 55)
1.2 Alternative zur
Standardausgabe
Oswald von Wolkenstein: Lieder.
Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählte Texte hrsg., übers. und
kommentiert von Burghart Wachinger. Melodien und Tonsätze hrsg. und kommentiert
von Horst Brunner. Stuttgart 2007 (= RUB 18490).
Alle Texte zu Oswald von Wolkenstein stehen zum kostenlosen
Download auf der Homepage der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft bereit:
www.wolkenstein-gesellschaft.com/texte_oswald/php
Weiteres Material
stellt das Archiv
der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft
an der Karl-Franzens-Universität Graz zur
Verfügung. Dieses Grazer Wolkenstein-Archiv befindet sich in der
Nachlass-Sammlung der UB Graz und wird
seit der Emeritierung von Anton Schwob (2005) von Wernfried Hofmeister betreut.
Bereits online aufzurufen sind u.a.: der Bestand des Archivs, der Kommentar von Werner
Marold (1926) sowie die Gesamtedition der Melodien durch
Oswald Koller (1902).
2. Gesamtübersetzung
Oswald
von Wolkenstein: Das poetische Werk. Gesamtübersetzung in neuhochdeutsche Prosa
mit Übersetzungskommentaren und
Textbibliographien von Wernfried Hofmeister. Berlin: De
Gruyter Verlag 2011.
3. Kommentar
Werner
MAROLD: Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein. Hrsg. von Alan
ROBERTSHAW. Innsbruck 1995 [Jetzt im Grazer
‘Wolkenstein-Archiv’ online aufzurufen – hier
klicken!]
4. Sekundärliteratur (Auswahl –
chronologisch)
MÜLLER, Ulrich: "Dichtung"
und "Wahrheit" in den Liedern OsvW: Die autobiographischen Lieder von
den Reisen. Göppingen 1968 (GAG 1).
SCHWOB, Anton: Oswald von Wolkenstein.
Eine Biographie. Bozen 1977.
SCHWOB, Anton u.a. (Hrsg.): Die
Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein, Edition und Kommentar, 4 Bände. Wien,
Köln 1999 / 2000 / 2004/ 2011.
HARTMANN, Sieglinde: Oswald von
Wolkenstein heute: Traditionen und Innovationen in seiner Lyrik. In: JOWG 15
(2005), S. 349-372.
SPICKER, Johannes: Oswald von
Wolkenstein. Die Lieder. Berlin 2007 (= Klassiker Lektüren 10).
HARTMANN, Sieglinde: Oswald von
Wolkenstein, in: Kindlers Literatur-Lexikon. 3., völlig neu bearbeitete
Auflage. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Stuttgart /Weimar 2009, Band 12,
418-420.
MÜLLER, Ulrich / SPRINGETH, Margarethe
(Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk – Rezeption. Berlin 2011 (mit
Gesamtbibliographie und Forschungsbericht).
HARTMANN, Sieglinde: Die deutsche
Liebeslyrik vom Minnesang bis zu Oswald von Wolkenstein oder Die Erfindung der
Liebe im Mittelalter. Wiesbaden 2012 (= Einführung in die deutsche Literatur
des Mittelalters, Band 1).
5. Diskographie
bzw. Einspielungen
SCHUBERT, Martin: Einspielungen von
Liedern Oswald von Wolkenstein. Mit einer Diskographie. In: MÜLLER, Ulrich /
SPRINGETH, Margarethe (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin 2011, 313-329.
Diskographie zusammengestellt von
Christine Müller auf:
http://www.wolkenstein-gesellschaft.com/diskographie.php

Unbekannter Maler, Oswald von Wolkenstein, Innsbrucker
Liederhandschrift von 1432, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Erstes
lebensechtes und lebensgroßes Porträt eines deutschsprachigen Autors
__________________________________________________________________________
Wintersemester 2012/13
Prof.
Dr. Sieglinde Hartmann
Hauptseminar
WS 2012/2013
Übungsraum
24 im Phil.-Gebäude
Zeit:
montags 16.00-19.00 Uhr, Beginn: 22.10.2012
Der 'Gregorius’ des
Hartmann von Aue und die Wiederkehr des Ödipusmythos
Bitte neuen Studienführer mit studienrelevanten Informationen inklusive Kursbeschreibungen auf der Homepage des Würzburger Instituts beachten:
Studiumsführer
Zu
den gelungensten Neuformungen antiker Mythenstoffe im Hochmittelalter
zählt Hartmanns Verserzählung von einem sagenhaften Papst Gregor
– obwohl der höfische Epiker seine Vorlage, die altfranzösische
Legende, ohne nachweisliche Kenntnisse des antiken Ödipus-Mythos aufgegriffen
hat. Gegenüber der antiken Form der Tragödie und dem damit eng
verbundenen Glauben an ein von Göttern verhängtes Schicksal
entwickelt der mittelalterliche Autor Erzählstrategien, welche es seinem
Protagonisten erlauben, einen für die Menschheit neuartigen Weg der
‚Katharsis’ zu finden.
Um
die Zusammenhänge von neuem christlichen Menschenbild und höfischer
Erzählkunst zu erfassen, werden wir Hartmanns ‚Gregorius’ aus
der Perspektive der Ödipus-Mythen der Antike in den Blick nehmen. Im
Gegenlicht der antiken Modelle werden wir sodann erarbeiten, wie der
mittelalterliche Epiker eine innere Umgestaltung der antiken Mythenmotive
erreicht. Unsere Hauptaufgabe wird es mithin sein zu erfragen, wie Hartmann von
Aue die Handlung strukturiert, wie er die Funktion der narrativen Instanz ausfüllt,
mit welchen erzählerischen Mitteln er das
Geschehen strukturiert und vorantreibt und wie er den Charakter seines
Titelhelden zu dem neuartigen ‚Heldentyp’ eines sündigen
Heiligen ausformt.
Textgrundlage:
Hartmann von Aue. Gregorius. Nach
dem Text von Friedrich Neumann neu herausgegeben, übersetzt und
kommentiert von Waltraud Fritsch-Rößler.
Stuttgart 2011 (Reclams UB 18764) - mit
neuester Sekundärliteratur,
oder
Hartmann von Aue. Gregorius. Der
Arme Heinrich. Iwein. Herausgegeben und
übersetzt von Volker Mertens. Frankfurt am Main 2008 (= Deutscher
Klassiker Verlag im Taschenbuch, Band 29) – ausführlichster Stellenkommentar
und aktualisierte Auswahl-Bibliographie.
Gregorius von Hartmann von Aue. Hrsg.
von Hermann Paul, neu bearbeitet von Burghart Wachinger.
15., durchgesehene und erweiterte Auflage. Tübingen 2004 – einsprachige Ausgabe mit wenigen
Erläuterungen, aber beste Übersicht über Überlieferung,
Seite VII-XV.
Quellen:
Hartmann von Aue, Gregorius. Die Überlieferung des Prologs, die Vaticana-Handschrift A und eine Auswahl der übrigen
Textzeugen in Abbildungen herausgegeben und erläutert von Norbert Heinze.
Göppingen 1974 (= Litterae Nr. 28) – schwarz-weiß-Faksimile
der Textüberlieferung.
Digitalisat der
Leithandschrift A in der
Apostolischen Bibliothek des Vatikan (Signatur: Rom, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Cod. Regin. Lat.
1354) aufrufbar über Nachweis in: Handschriftencensus.
Marburger Repertorium. Deutschsprachige Handschriften
des 13. und 14. Jahrhunderts:
http://www.fgcu.edu/rboggs/Hartmann/Gregorius/GrImages/GrGetImagesA.asp
Textausgabe
der altfranzösischen Vorlage:
La vie du pape Saint Grégoire ou
La Légende du bon pécheur. Leben des heiligen Papstes Gregorius
oder die Legende vom guten Sünder. Text nach der Ausgabe von Hendrik
Bastian Sol mit Übersetzung und Vorwort von Ingrid Kasten. München
1991 (= Klassische Texte des romanischen Mittelalters in zweisprachigen
Ausgaben 29).
Vollständige Bibliographien bzw. Monographien:
Elfried Neubuhr: Bibliographie zu Hartmann von Aue. Berlin 1976.
Hartmann
von Aue. Mit einer Bibliographie. Hrsg. von Petra Hörner. Frankfurt am
Main et al. 1998.
Christopf Cormeau und Wilhelm Störmer:
Hartmann von Aue. Epoche – Werk
– Wirkung. 3. Aufl. München 2007.
Jürgen Wolf: Einführung in
das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007 – nicht ohne Fehler, aber neueste Monographie.
Neuere
Sekundärliteratur zu mediävistischer Erzählforschung (Narratologie)
und zur literaturwissenschaftlichen Intertextualität:
Überblick
im Artikel „Narratologie“ in: Metzler Lexikon Literatur. 3. Aufl.
Stuttgart / Weimar 2007.
Ulrich
Broich: Intertextualität. In: Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung. Band 2. Berlin 2000, 175-179.
Gérard
Genette: Die Erzählung. 3., durchgesehene und korrigierte Auflage
übersetzt von Andreas Knop mit einem Nachwort
von Jochen Vogt überprüft und berichtigt von Isabel Kranz.
München 2010.
Wolfram-Studien XVIII.
Erzähltechnik und Erzählstrategien in der deutschen Literatur des
Mittelalters. Saarbrücker Kolloquium 2002. Hrsg. von Wolfgang Haubrichs, Eckart C. Lutz, Klaus Ridder.
Berlin 2004; darin Einleitung sowie
die folgenden Beiträge:
Monika Unzeitig: Von der
Schwierigkeit zwischen Autor und Erzähler zu unterscheiden. Eine
historisch vergleichende Analyse zu Chrétien
und zu Hartmann. In: Wolfram-Studien XVIII. Berlin 2004, 59-81.
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
Monika
Unzeitig: Autorname und Autorschaft: Bezeichnung und Konstruktion in der
deutschen und französischen Erzählliteratur des 12. und 13.
Jahrhunderts. Berlin/New York 2010.
Historische
Narratologie – Mediävistische Perspektiven. Hrsg. v. Haferland,
Harald / Meyer, Matthias. Berlin/New York 2010.
Armin
Schulz: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. Berlin/New York
2012.
Neuere
Sekundärliteratur zur literaturwissenschaftlichen und zur
mediävistischen Mythosforschung:
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008.
Band
1: Herrscher Helden Heilige; darin Einleitung, sowie ARTIKEL zu Karl der
Große, Sankt Georg, Der Heilige Franz von Assisi; Band 2: ARTIKEL zum
Teufel; Band 3: ARTIKEL Judas Ischariot.
ARTIKEL
‚Mythologie’ und ‚Mythos’, in:
Metzler Lexikon Literatur. 3. Aufl. Stuttgart / Weimar 2007 (= grundlegende literaturwissenschaftliche
Definition).
Neuere
Sekundärliteratur zur Diskussion über Helden und Heilige:
Bernd
Bastert: Helden als Heilige. Chanson de geste-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Tübingen
2010 (besonders: Vorwort).
Helden
und Heilige: kulturelle und
literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Hrsg. von
Andreas Hammer. Heidelberg 2010 (besonders:
Vorwort) sowie darin
Jing Xuan: Erzählen im Schwellenraum: Die Legende des
sündigen Hl. Grégoire, Seite 197-214.
Ulrich
Müller: Heldenbilder der Antike und des europäischen Mittelalters:
Eine tour d’horizon. In: Das Nibelungenlied und das Buch des Dede
Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des
zweiten interkulturelles Symposiums in Mainz,
Deutschland, 2011. Herausgegeben von Kamal M. Abdullayev, Hendrik Boeschoten
und Sieglinde Hartmann . Reichert
Verlag Wiesbaden 2013 (in Vorbereitung, elektronisch zur Verfügung
gestellt).
Im Folgenden verweise ich
nur auf die wichtigsten (neueren) Titel, weitere Sekundärliteratur muss
selbst zu dem betreffenden Thema recherchiert werden!
Sitzungsplan
1) 22.10.2012 – Einführung, Erläuterung des
Seminarplans, Verteilung der Referate / Hausarbeiten
2) 29.10.2012
– Hartmanns
Prolog, die afz. Vorlagen und die Gattungsproblematik
Themen:
a) Die afz. Vorlagen zu Hartmanns
‚Gregorius’, die Überlieferung von Hartmanns
‚Gregorius’ und die bisherigen Versuche der Gattungsbestimmung
Sekundärliteratur:
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007, dort bibliogr. Nachweise;
Zusammenfassung
der Diskussion im Vorwort der Ausg. der afrz. Legende
von I. Kasten sowie Nachwort der Ausgaben von W. Fritsch-Rößler
+ V. Mertens;
Fritz
Peter Knapp: legenda aut
non legenda. Erzählstrukturen und
Legitimationsstrategien in ‚falschen’ Legenden des Mittelalters:
Judas – Gregorius – Albanus. In: Germanisch-Romanische
Monatsschrift. 53. 2003, 133-154.
b)
Der Prolog des ‚Gregorius’: Inhaltlicher Aufbau, rhetorische
Gestaltung und narrative Funktion
Sekundärliteratur:
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007 –
dort Erläuterungen + Literaturhinweise + Kommentare in den Editionen von Fritsch-Rößler und Mertens.
3) 05.11.2012
– Die Handlungsstruktur des ‚Gregorius: Antike
und mittelalterliche Muster einer Heldenbiographie
Themen:
a) Der Ödipus-Mythos von der griechischen Antike bis zum Mittelalter
– eine stoffgeschichtliche Zusammenfassung
Sekundärliteratur:
Artikel
ÖDIPUS in: Elisabeth Frenzel: Stoffe der
Weltliteratur. 10. Aufl. Stuttgart 2005.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
Mythos Ödipus. Texte von Homer bis
Pasolini. Hrsg. von Nikola Rossbach. Leipzig 2005 – Textsammlung mit
Erläuterungen.
b) Heilige
Helden des Mittelalters und ihre Gestaltung in der deutschen Literatur des
Mittelalters: Karl der Große (‚Rolandslied’ des Pfaffen
Konrad), Hl. Gregorius (Hartmann von Aue) und Hl. Georg (Konrad von
Würzburg)
Sekundärliteratur:
Ulrich Wyss: Legenden, in: Epische Stoffe des Mittelalters. Hrsg.
von Volker Mertens und Ulrich Müller. Stuttgart 1984;
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 1: Herrscher Helden Heilige; darin Einleitung, sowie
ARTIKEL zu Karl der Große, Sankt Georg.
Bernd
Bastert: Helden als Heilige. Chanson de geste-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Tübingen
2010 (besonders: Vorwort).
Ulrich
Müller: Heldenbilder der Antike und des europäischen Mittelalters:
Eine tour d’horizon. In: Das Nibelungenlied und das Buch des Dede
Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des
zweiten interkulturellen Symposiums in Mainz,
Deutschland, 2011. Herausgegeben von Kamal M. Abdullayev, Hendrik Boeschoten
und Sieglinde Hartmann . Reichert
Verlag Wiesbaden 2013 (in Vorbereitung, elektronisch zur Verfügung
gestellt).
4) 12.11.2012
– Der Handlungsbeginn im ‚Gregorius’ und die Rolle des
Erzählers
Themen:
a)
Die Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler in den Erzählwerken
Hartmanns von Aue: ‚Erec’, ‚Iwein’, ‚Gregorius’ und ‚Armer
Heinrich’
Sekundärliteratur:
Monika
Unzeitig: Von der Schwierigkeit zwischen Autor und Erzähler zu
unterscheiden. Eine historisch vergleichende Analyse zu Chrétien
und zu Hartmann. In: Wolfram-Studien XVIII. Berlin 2004, 59-81.
b)
Die Funktion des Erzählers in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Cornelia
Johnen: Analyse der narrativen Funktion des Erzählers in Hartmanns von Aue
‚Gregorius’. München 2011 (Online-Ressource).
5) 19.11.2012 – Inzestgeburt
des ‘neuen’ Helden: die Eltern zwischen Selbstbestimmung und
Fremdbestimmung – Vers 451-500
Themen:
a)
Inzest im mittelalterlichen Recht und in den mittelalterlichen Legenden von den
Inzest-Heiligen Metro von Verona, Albanus und Gregorius
Sekundärliteratur:
Artikel
INZEST in: Elisabeth Frenzel: Motive der
Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
Artikel
INZEST in Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte + Lexikon des
Mittelalters.
Alexandra
Rassidakis: Von Liebe und Schuld. Inzest in Texten
von Hartmann von Aue, Th. Mann und Jeffrey Eugenides.
In: literatur für leser.
2005, 65-84.
b)
Gestaltung des Geschwisterinzests in der afz. ‚Vie
du pape saint Grégoire’ und in Hartmanns
‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte
Herlem-Prey: Le ‚Gregorius’ et la
‚Vie de Saint Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen 1979.
Alexandra
Rassidakis: Von Liebe und Schuld. Inzest in Texten
von Hartmann von Aue, Th. Mann und Jeffrey Eugenides.
In: literatur für leser.
2005, 65-84.
6)
26.11.2012 – Aussetzung des Kindes in antiken
Ödipusmythen, in der
Bibel, in den altnordischen Siegfriedsagen und bei
Hartmann – Vers 924-938 + 1008-1033
Themen:
a)
Aussetzung des Kindes in antiken Ödipus-Mythen, in der Bibel (Moses), in
römischen Mythen von Romulus und Remus und in der ‚Thidrekssaga’ (Sigurd/Siegfried)
Sekundärliteratur:
Artikel
HERKUNFT, Die unbekannte in: Elisabeth Frenzel:
Motive der Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
FitzRoy Richard Somerset Raglan: The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama. London
Materialen
zu meiner Vorlesung mit vergleichender Motivtabelle Ödipus –
Gregorius.
b)
Die Aussetzung des Kindes in der afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’
und in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Joachim
Theisen: Des Helden bester Freund. Zur Rolle Gottes bei Hartmann von Aue,
Wolfram und Gottfried. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches in
geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 153-169.
Hausmann,
Albrecht: Gott als Funktion erzählter Kontingenz: Zum Phänomen der
„Wiederholung“ in Hartmanns von Aue ‚Gregorius. In: Kein
Zufall: Konzeptionen von Kontingenz in der
mittelalterlichen Literatur. Hrsg. von Cornelia Herberichs.
Göttingen 2010, 79-109
7) 03.12.2012 – Gregorius’
Jugend und die Entdeckung seiner
Findlingsherkunft: Einbruch
neuer mythischer Motive? Vers 1285-1335 + 1359-1374
Themen:
a) Muster von Kindheit und Jugend in Hartmanns ’Gregorius’,
in Gottfrieds ‚Tristan’ und in Wolframs ‚Parzival’
Sekundärliteratur:
Matthias
Winter: Kindheit und Jugend im Mittelalter. Freiburg i.Br. 1984.
Madeleine Pelner
Cosman: The Education of the Hero in Arthurian Romance.
Chapel Hill 1965.
David A. Wells: Fatherly Advice. The Precepts of ‘Gregorius’, Marke, and Gurnemanz and the
School Tradition of the (Disticha Catonis’.
(…).
In: Frühmittelalterliche Studien. 28. 1994, 296-332.
b) Heldenjugend und Entdeckung der Findlingsherkunft im antiken
Ödipus-Mythos, in der mittelalterlichen Judaslegende, in Hartmanns
‚Gregorius’ und ihre Funktion im Handlungsverlauf
Sekundärliteratur:
Artikel
HERKUNFT, Die unbekannte in: Elisabeth Frenzel:
Motive der Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, 165-199.
8) 10.12.2012 – Das Streitgespräch zwischen dem Abt und Gregorius und
die 1. Ausfahrt des Helden Vers 1385-1850
Themen:
a)
Die mittelalterliche Gattung des Streitgesprächs und die Struktur des
Streitgesprächs zwischen Abt und Gregorius bei Hartmann
Sekundärliteratur:
Paul
Michel: Mit Worten tjôstieren. Argumentationsanalyse
des Dialogs zwischen dem Abt und Gregorius bei Hartmann von Aue. In:
Germanistische Linguistik. 1979, 195-215.
Anja
Becker: Die göttlich geleitete Disputation: Versuch einer
Neuinterpretation von Hartmanns ‚Gregorius’ ausgehend vom Abtgespräch. In: Disputatio
1200-1800: Form, Funktion und Wirkung eines
Leitmediums universitärer Wissenskultur. Hrsg. von Marion Gindhart und Ursula Kundert. Berlin/New
York 2010, 331-361.
b)
Die Bewertung der ritterlichen Lebensform aus Sicht des Abtes und aus Sicht des
Gregorius in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Hans-Georg
Reuter: Die Lehre vom Ritterstand. Zum Ritterbegriff in Historiographie und
Dichtung vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. 2. Aufl. Köln, Wien 1974.
Kerstin
Schmitt: Körperbilder, Identität und Männlichkeit im ‚Gregorius’.
In: Genderdiskurse und Körperbilder im
Mittelalter. (…). Hrsg. von Ingrid Bennewitz
und Ingrid Kasten. Münster 2002, 135-155.
9) 17.12.2012 – Gregorius’ 1. Begegnung mit der
Mutter und seine 1. Heldentat; Heirat und inzestuöses Eheleben –
Vers 1894-2518
Themen:
a)
Das Motiv des Sehens und die narrative Fokalisierung in der 1. Begegnungsszene
mit Mutter und Sohn
Sekundärliteratur:
Artikel
QUINQUE LINEAE AMORIS, in: Sachwörterbuch der Mediävistik. Hrsg. von
Peter Dinzelbacher. Stuttgart 1992.
Gerhard
Wolf: Sieht man mit dem ‚inneren Auge’ besser? Zu Formen und
Funktion visueller Wahrnehmung im mittelniederländischen ‚Roman van Walewein’. In: Sehen und Sichtbarkeit in der
Literatur des deutschen Mittelalters. XXI. Anglo-German
Colloquium London 2009. Hrsg. von Ricarda Bauschke,
Sebastian Cox, Martin H. Jones. Berlin 2011, 211-227.
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
b)
Erste Heldentat und der Mutter-Sohn-Inzest im antiken Ödipus-Mythos, in der
afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’ und
in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
10)
07.01.2013 – Die
Entdeckung des Inzests, die biblischen Beispielfiguren
(Judas und
König David), die Buße der Mutter und die Trennung des Paares
– Vers 2519-2747
Themen:
a) Die narrative Funktion der biblischen Beispielfiguren bei der
Entdeckung des Inzests im Kontext der extradiegetischen
Bemerkungen in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Ulrich Ernst: Der
‚Gregorius’ des Hartmann von Aue. Theologische Grundlagen – legendarische Strukturen – Überlieferung im
geistlichen Schrifttum. Köln 2002.
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 3: ARTIKEL Judas Ischariot.
Hartmut Freytag: „diu seltsaenen maere / von dem guoten sündaere“. Über die heilsgeschichtlich
ausgerichtete interpretatio auctoris
im ‚Gregorius’ Hartmanns von Aue. In: Euphorion.
98. 2004, 265-281.
b) Die Funktion des Teufels bei den Inzesten in der afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’ und
in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Arnold
Angenendt: Geschichte der Religiosität im
Mittelalter. Darmstadt 1997, Kapitel „Engel und Teufel.
Ingrid
Kasten im Vorwort zur afz. Textausgabe.
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 2: ARTIKEL zum Teufel.
11)
14.01.2013 – Strafe
für den Inzest: Gregorius’ 2. Heldentat (Buße) und seine
Verwandlung in
einen Heiligen – Vers 2751-3144.
Themen:
a)
Gregorius’ 2. Ausfahrt und die narrative Gestaltung der Verwandlung in
einen Heiligen
Sekundärliteratur:
Peter
Strohschneider: Inzest-Heiligkeit. Krise und Aufhebung der Unterschiede in
Hartmanns ‚Gregorius’. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches
in geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 105-133.
Harald
Haferland: Metonymie und metonymische Handlungskonstruktion erläutert an
der Konstruktion von Heiligkeit in zwei mittelalterlichen Legenden. In: Euphorion. 99. 2005, 323-365.
b)
Verwandelt der Erzähler Gregorius tatsächlich in einen heiligen Eremiten?
Eine kritische Sichtung der Forschung, speziell von V. Mertens Monographie
Sekundärliteratur:
Erhard
Dorn: Der sündige Heilige in der Legende des Mittelalters. München
1967.
Peter
Strohschneider: Inzest-Heiligkeit. Krise und Aufhebung der Unterschiede in
Hartmanns ‚Gregorius’. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches
in geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 105-133.
12) 21.01.2013
– Gregorius’ Erwählung zum Papst und die Wunder seiner 2.
Auffindung: neues Heiligenideal – Vers 3137-3830
Themen:
a)
Die Funktion der Fischer als Handlungsträger in Hartmanns
‚Gregorius’
b)
Gregorius und sein neues Heiligenideal im Kontext der mittelalterlichen Heiligenverehrung
Sekundärliteratur:
Peter
Dinzelbacher / Dieter Bauer (Hrsg.): Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. Ostfildern
1990, 10-17.
Artikel
HEILIGE, in: Lexikon des Mittelalters.
Helden
und Heilige: kulturelle und
literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Hrsg. von
Andreas Hammer. Heidelberg 2010 (besonders:
Vorwort) sowie darin
Jing Xuan: Erzählen im Schwellenraum: Die Legende des
sündigen Hl. Grégoire, Seite 197-214.
13)
28.01.2013 – Die
Zusammenführung von Mutter und Sohn im ‚Gregorius’:
Das Ende des mythischen Heros
Ödipus und des heiligen Heros Gregorius – Vers 3831 - 4006
Themen:
a)
Das Motiv des Sehens und die narrative Fokalisierung in der 2. Begegnungsszene
mit Mutter und Sohn
Sekundärliteratur:
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
b)
Das Ende des mythischen Heros
Ödipus und des heiligen Helden Gregorius – eine christliche
Überwindung antiker Tragik?
Sekundärliteratur:
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
WEITERE MATERIALIEN WERDEN AUF DIESER HOMEPAGE ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT!
_________________________________________________________________________
VORLESUNG SS 2012
Vorlesung Sommersemester 2012 Prof. Dr. SIEGLINDE HARTMANN
Der
‘Gregorius’ des Hartmann von Aue und die Wiederkehr des Ödipusmythos
Beginn der
Lehrveranstaltungen: Montag 23. April 2012
Ort:
Philosophiegebäude Hörsaal 2
Mittelalter-Mythen zu erforschen gehört zu den
jüngsten Forschungsfeldern der Mediävistik. Neben dem Wiederaufleben von
germanischen und keltischen Mythen, stellt uns besonders die
hochmittelalterliche Wiederkehr von Mythen aus der griechischen und römischen
Antike vor zahlreiche ungelöste Rätsel. Auffällig, aber weitgehend ungeklärt,
bleibt unter anderem, dass die gelungensten Beispiele einer inneren Umformung
antiker Mythen und ihrer Zentralgestalten im Medium der neuen literarischen
Gattungen höfischer Erzählkunst entstanden sind.
Ohne nachweisliche Kenntnis des antiken
Ödipus-Mythos hat der höfische Epiker Hartmann von Aue gegen Ende des 12.
Jahrhunderts die mittelalterliche, altfranzösische Legende von einem
sagenhaften Papst Gregor aufgegriffen, um an seinem Schicksal darzulegen, welch
gnadenhafte Wendung eine inzestuöse Mutter-Sohn-Beziehung erfahren kann.
Gegenüber der antiken Form der Tragödie und dem damit eng verbundenen Glauben
an ein von Göttern verhängtes Schicksal entwickelt der mittelalterliche Autor
Erzählstrategien, welche es seinem Protagonisten erlauben, einen für die
Menschheit neuartigen Weg der ‘Katharsis’ zu finden.
In der Vorlesung soll daher Hartmanns
Verserzählung im Gegenlicht der antiken Modelle beleuchtet werden, um
herauszufinden, wie der mittelalterliche Erzähler eine innere Umgestaltung der
antiken Mythenmotive erreicht.
Gleichzeitig soll gezeigt, wie der deutsche
Epiker Hartmann seine altfranzösische Vorlage in einigen Handlungsmotiven so
umgestaltet, dass die inneren Wandlungen seines Protagonisten plastischer
profiliert erscheinen und am Ende in eine christliche Remythisierung der
antiken Ödipusfabel münden.
Aus dieser Perspektive wird die Vorlesung einen
Überblick über die wesentlichen Interpretationsprobleme bieten, wie sie die
aktuelle mediävistische Forschung zu Hartmanns ‘Gregorius’ beherrschen.
Textgrundlage: Hartmann von Aue. Gregorius. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch.
Nach dem Text von Friedrich Neumann neu herausgegeben, übersetzt und
kommentiert von Waltraud Fritsch-Rößler. Stuttgart 2011 [Reclams UB 18764].
Zur Einführung:
Christoph Cormeau: Hartmann von Aue, in: Die
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Band 3, Spalten 500-520;
Christoph Cormeau und Wilhelm Störmer: Hartmann
von Aue. Epoche – Werk – Wirkung. 3. Aufl. München 2007.
Francis
G. Gentry: A Companion to the Works of Hartmann von Aue. Rochester et. al. 2005.
Ulrich Müller, Werner Wunderlich (Hrsg.):
Mittelalter-Mythen. Band 1: Herrscher, Helden, Heilige. St. Gallen 1996,
Einleitung, S. IX-XIV.
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007.
SPRECHSTUNDE:
MONTAGS 14.00 bis 15.00 Uhr
Folgende Terminübersicht zeigt an, zu welchem Zeitpunkt und Frist die Anmeldung zu Prüfungen getätigt werden kann:
VORLESUNGSPLAN
1)
Montag 23. April 2012
Einführung: Hartmann von Aue und sein ‘Gregorius’
2) Montag 30. April 2012
Die mittelalterliche Legende und der antike Mythos:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
3)
Montag 07. Mai 2012
Inzestgeburt des
‘neuen’ Helden: die Eltern zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung – Vers
451-500
Materialien Literatur + Definitionen VL 3
4)
Montag 14. Mai 2012
Auffindung des
Kindes in antiken Ödipusmythen, in der Bibel und bei Hartmann – Vers 924-938 +
1008-1033
5)
Montag 21. Mai 2012
Gregorius’
Jugend und seine erste Missetat: Einbruch mythischer Motive? Vers 1285-1335 +
1359-1374
6)
Montag 04. Juni 2012
Gregorius’ 1.
Ausfahrt und Begegnung mit der Mutter: das mythische Motiv der Blindheit und
seine christliche Umdeutung – Vers 1894-1969
7)
Montag 11. Juni 2012
Gregorius zweite
Missetat: sein inzestuöses Eheleben und das Motiv der allmorgendlichen Buße –
Vers 2224-2294
8)
Montag 18. Juni 2012
Die Entdeckung
des Inzests und die biblischen Beispielfiguren sündiger Verzweiflung – Vers
2589-2663
9)
Montag 25. Juni 2012
Strafe für den
Inzest: Ödipus und sein Sohn Polyneikes, Gregorius’ Buße und der Fischer – Vers
3274-3370
10)
Montag 2. Juli 2012
Die 2. Auffindung des Gregorius und das neue ‘Heldenideal’ des “gottes trût” – Die
Metamorphose antiker Heroen in selbstbestimmte christliche Helden
MATERIALIEN ZUR VORLESUNG
STEHEN AUF MEINER
HOMEPAGE ZUM DOWNLOAD BEREIT:
http://www.sieglinde-hartmann.com
BUTTON: Academic Program
_________________________________________________________________________
Prof
Prof. Dr.
Sieglinde Hartmann
Hauptseminar
WS 2011/2012
Mit
Gastkonzert von Dr. Silvan Wagner
(Universität
Bayreuth) am 06.02.2012
Raum: 2.003
im Zentralen Hörsaal- und
Seminargebäude
Zeit: montags
16.00-18.30 Uhr, Beginn: 24.10.2011
DIE DEUTSCHE
LIEBESLYRIK VOM KÜRENBERGER BIS ZU OSWALD VON WOLKENSTEIN
Bis
heute bleibt erstaunlich, wie rasch sich die erste profane Liebesdichtung in
deutscher Sprache seit der Mitte des 12. Jahrhunderts unter dem Einfluss der
höfisch ritterlichen Dichtung nach französischem Vorbild zu einer
eigenständigen, bis heute unübertroffen variantenreichen Liedkunst entfaltet
hat. Besonders faszinierend wirkt, mit welch nachhaltiger Suggestivkraft die
deutschen Minnesänger die profane Liebe zum alles beherrschenden Thema
entwickelt haben, welches das Geschlechterverhältnis weit über ihre Zeit hinaus
prägen sollte.
Ziel
des Hauptseminars ist es, den poetischen Erfindungsreichtum und die
Originalität der einzelnen Dichterpersönlichkeiten anschaulich zu machen. Daher
sollen charakteristische Lieder aller Entwicklungsphasen vom frühen ‘donauländischen’ Minnesangs (von ca. 1150) bis zu Oswald
von Wolkenstein (ca. 1410-1430) in Einzelanalysen erarbeitet werden. Die
Liedauswahl soll gleichzeitig dazu dienen, die mittelalterliche deutsche
Liebeslyrik in ihrer gattungstypischen Entfaltung, metrischen Baukunst und
überlieferungsgeschichtlichen Eigenart zu erhellen.
Ein
Leistungsnachweis kann aufgrund eines Referats (+ schriftliche Fassung) oder
mittels einer Hausarbeit erworben werden.
S i t z u n g s p l a n
1)
24.10.2011 – Einführung: Entstehung des Minnesangs und Entwicklungsphasen der
Liebeslyrik bis zu Oswald von Wolkenstein, Überlieferung der Minnelyrik
(Budapester Fragment, Hss. A, B, C + Wolkenstein-Hss.), Sangbarkeit = höfische Liedkunst;
Erläuterung des Seminarplans, Verteilung der Referate / Hausarbeiten
2)
31.10.2011 – Der Kürenberger und der ‘Donauländische Minnesang’
Themen:
a) Das
‘Falkenlied’ des Kürenbergers in der Überlieferung
der Großen Heidelberger Liederhandschrift C und im Budapester Fragment;
b) Gender Aspekte bei der Liedlyrik des Kürenbergers:
Polarisierung von weiblichen und männlichen Rollen;
c) Die
Rezeption des ‘Falkenlieds’ im ‘Nibelungenlied’: Kriemhilds Falkentraum (1. Âventiure)
3)
07.11.2011 – Frühhöfischer Minnesang: Heinrich von Veldeke
(MF XII) und Kaiser Heinrich VI.
Themen:
a) Die Minne
als neue ‘Göttin’ der Liebe bei Heinrich von Veldeke
– Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation des Liedes MF XII;
b) Das Lob
Gottfrieds von Straßburg auf Heinrich von Veldeke und
die Einführung französischer Formkunst sowie der Konzeption der Hohen Minne in
den deutschen Minnesang;
c) Kaiser
Heinrich VI. als Minnesänger: ein Profil seiner Persönlichkeit als Kaiser und
als Minnesänger mit Interpretation des Liedes MF III.
4) 14.11.2011 –
Friedrich von Hausen: Hohe Minne, ‘Fernliebe’ und Kreuzzugslyrik
Themen:
a) Die
Konzeption der Hohen Minne bei Friedrich von Hausen: Übersetzung, metrisches
Schema und Interpretation des Liedes MF XIV;
b) Kaiser
Friedrich Barbarossas Kreuzzug (1187-1192), die Kreuzzugsteilnahme Friedrichs von
Hausen und seine Bearbeitung des französischen Kreuzzugsliedes ‘Ahi, Amours!’ im Lied MF VI.
5)
21.11.2011 – Albrecht von Johansdorf: Kreuzzugslyrik und
‘Herzensliebe’
Themen:
a) Albrecht
von Johansdorf und die ‘Herzensliebe’: Überlieferung
und inhaltliches Profil seiner Lieddichtungen mit Fokussierung auf Lied MF VIII
‘Wie sich minne hebt, daz weiz ich wol’;
b) Die
Kreuzzugsthematik bei Albrecht von Johansdorf und
Friedrich von Hausen: Parallelen und Unterschiede in ihrer Bearbeitung des
französischen Kreuzzugsliedes ‘Ahi, Amours!’.
6)
28.11.2011 – Hartmann
von Aue MF XV: ‘Unmutslied’
Themen:
a) Hartmann
von Aue und die Relevanz der Minnethematik in seinen höfischen Romanen ‘Erec’ und ‘Iwein’;
b) Hartmann
von Aue: der erste Kritiker der Hohen Minne? Eine Interpretation mit
Übersetzung und metrischem Schema des ‘Unmutsliedes’ (MF XV).
7) 05.12.2011 – Wolfram
von Eschenbach: Tagelieder
Themen:
a)
Wolfram von Eschenbach, sein episches Werk und die Relevanz der Minnethematik
in seinem höfischen Roman ‘Parzival’;
b) Das Tagelied
im deutschen Minnesang: Herkunft und Profil einer Liedgattung vom Minnesang bis
zu Oswald von Wolkenstein;
c)
Wolframs Tagelied ‘Sîne klâwen’
– Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
Literatur und Arbeitsbücher zur deutschen Literatur des Mittelalters
8)
12.12.2011 – Heinrich von Morungen: Tagelieder und ‘Traumliebe’
Themen:
a) Heinrich
von Morungen, Überlieferung und thematische Schwerpunkte seiner Lieddichtungen;
b) Heinrich von
Morungen und seine Poetik des Schauens: Übersetzung, metrisches Schema und
Interpretation des Lieds MF XIII;
c) Das
Tagelied ‘Owê’ (MF XXX) Heinrichs von Morungen und
seine Bildregie: Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
9)
19.12.2012 – Heinrich von Morungen: ‘Narzisslied’ – südfranzösisches Vorbild
und Antikenrezeption
Themen:
a) Die
Rezeption antiker (römischer und griechischer) Mythenstoffe in der höfischen
Literatur und im Minnesang: Heinrich von Veldekes Eneasroman und die Ovid-Rezeption im Minnesang;
b) Der antike Mythos von Narziss und seine
Wiederaufnahme im ‘Narzisslied’ bei Heinrich von Morungen und seinem anonymen
französischen Vorbild.
Titelblatt+Gliederung Hausarbeit
Gebrüder Grimm: Möringers Wallfahrt
10)
09.01.2012 – Reinmar: Minneklagen und Minneleid
Themen:
a)
Reinmar der Alte: Überlieferung und thematisches Spektrum seiner
Lieddichtungen;
b) Reinmar als
Meister der Minneklage: Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation des
Lieds MF XV.
11) 16.01.2012 – Walther
von der Vogelweide: Lieder der Hohen Minne und das ‘Lindenlied’
Themen:
a) Walther
von der Vogelweide und die neuen thematischen Schwerpunkte seines Minnesangs:
Lieder der ‘niederen Minne’ und der ‘hohen Minne’;
b) Walther
von der Vogelweide und die Interpretationen seines ‘Lindenlieds’: Übersetzung,
metrisches Schema und kritische Reflexion der Forschung.
12) 23.01.2012 – Oswald
von Wolkenstein: Pastourellen und Tagelieder
Themen:
a) Oswald von
Wolkenstein: Überlieferung, thematische Gliederung und Innovationen seiner
Liedkunst;
b) Wolkensteins
Variationen des Tagelieds und sein ‘Antitagelied’: Übersetzung, metrisches
Schema und Interpretation des Lieds ‘Ain tunckle farb’ (Kl 33);
c) Wolkensteins
Pastourellen: Gattungsprofil am Beispiel des Liedes
‘Ain jetterin’ (Kl 83).
13) 30.01.2012 – Oswald
von Wolkenstein: Liebeslieder
Themen:
a) Liebe und
Erotik in Wolkensteins Lieddichtungen: die unterschiedlichen Liedgattungen und
ihre divergierende Wertungen;
b) Wolkensteins
Lieder an Margarete von Schwangau: Zuordnung zu Liedgattungen und Profil der
formalen wie inhaltlichen Innovationen;
c) Das
Liebesduett ‘Simm Gredlin,
Gret’ (Kl 77): Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
14) 06.02.2012 Gastkonzert von Dr. Silvan Wagner (Universität Bayreuth)
Textgrundlage:
Minnesang:
Mittelhochdeutsche Liebeslieder. Mhd. / Nhd. Eine Auswahl hrsg. von Dorothea
Klein. Stuttgart 2010 (= Reclam UB 18781), EUR 16,00 (mit
Auswahlbibliographie zu den Liedtexten);
oder
Deutsche
Gedichte des Mittelalters. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählt,
übersetzt und erläutert von Ulrich Müller. In Zusammenarbeit mit Gerlinde
Weiss. 2. Auflage Stuttgart: 2009 ( = Reclam UB 8849); EUR 12,80 (mit Auswahlbibliographie zu den Liedtexten und Autoren).
Die Texte zu
Oswald von Wolkenstein stehen zum Download auf der Homepage der Oswald von
Wolkenstein-Gesellschaft: www.wolkenstein-gesellschaft.com/texte_oswald/php.
Sekundärliteratur:
Johannes Spicker: Oswald von Wolkenstein. Die Lieder.
Berlin 2007 (= Klassiker Lektüren 10); Ulrich Müller / Margarethe Springeth (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin 2011 (mit Gesamtbibliographie).
DIE
THEMEN EIGNEN SICH FÜR REFERATE UND/ODER HAUSARBEITEN.
__________________________________________________________________________
Sieglinde Hartmann - Deutsche Klassiker der Weltliteratur: Das
‚Nibelungenlied’
Prof. Dr.
Sieglinde Hartmann. WS 2010/2011
Hauptseminar
in Übungsraum 10, montags 16.00–19.00, Beginn: 25.10.2010
Mittelalterliche Heldenepik:
Das
"Nibelungenlied" auf Basis der Hs. C
S i t z u n g s p l a n
Gastvortrag
(24.01.2011) von Prof. Dr. Horst Brunner (Würzburg)
über die mhd. Sangversepik und ihre Melodien,
anschließend
Gastkonzert: Das
‘Nibelungenlied’ in Ausschnitten dargeboten von Dr. Eberhard Kummer (Bassbariton,
Schoßharfe), 17:15-19:00
1) 25.10.2010: Einführung in Lektüre und Transkription der Hs. C +
Erläuterung der Seminararbeit
Montag 1. November ist Feiertag: keine Sitzung!
2) 8.11.2010 a)
Stofftraditionen: Geschichte, Sagenkreise und altnordische Überlieferung; b) der Prolog im Mittelalter und in Hs. C – Thema für Referat
bzw. Hausarbeit; c) Interpretation der Strophen 1-11: epische Neuformung
des Nibelungenstoffs und Gliederung der Handschriften in Åventiuren
3) 15.11.2010 a) das ‘Falkenlied’ des Kürenbergers
(MF I, 6-7) und Kriemhilds Falkentraum in der 1. Åventiure:
Liebeskonzeption, Männlichkeitsideal, Strophenform – Thema für Referat bzw.
Hausarbeit; b) Gudruns Traum in der ‘Völsungensaga’
und Kriemhilds Traum im NL (Str. 12-18)
4) 22.11.2010 a) die Gestalt Siegfrieds in altnordischer Überlieferung, im
‘Hürnen Seyfried’ und im NL
– Thema für Referat bzw. Hausarbeit; b) Siegfrieds ‘minne’
und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 279-306) – Einfluss des Minnesangs
5) 29.11.2010 a) die Gestalt Brünhilds in
altnordischer Überlieferung und im NL – Thema für Referat bzw. Hausarbeit;
b) Gunthers Brautwerbung (Str. 391-477): Formen symbolischer Kommunikation,
neuartige Erzählregie und die Funktion des Doppelbetrugs im NL
6) 6.12.2010 Brünhild in Worms
und ihre 2. Brautnacht (Str. 664-691): Umfunktionierung
mythischer Heldenepikmotive
7) 13.12.2010 a) Der heldische Affekt des
‘Zorns’ in archaischer Heldenepik und der "nît" in
christlich-mittelalterlicher Sündenlehre – Thema für Referat bzw. Hausarbeit;
b) Streit der Königinnen (Str. 823-838 + 845-853): Worin bestehen "zorn" und "nît" der Königinnen im
NL, und warum führen diese Motive zur Peripetie der Haupthandlung?
8) 20.12.2010 a) Xanten und die Verehrung des Hl. Viktors im Mittelalter –
Thema für Referat bzw. Hausarbeit; b) Ermordung Siegfrieds (Str. 924-925
+ 978-1010) – Realismus und Symbolik der Schauplatzschilderung: Christliche Remythisierung eines Vorzeithelden?
9) 10.01.2011 a) Rache im Alten Testament und in mittelalterlicher
Rechtsgeschichte: Rekonstruktion mittelalterlicher Rechtsnormen– Thema für
Referat bzw. Hausarbeit; b) Kriemhilds Trauer, Etzels Brautwerbung und
Kriemhilds Rache im NL (Str. 1273-1287) – Melker Fragment Str. 1170,4-1172,2 +
1175,1-1176,4 in Hs. B beachten!
10) 17.01.2011 a) Hagen in altnordischer Überlieferung und im NL – Thema
für Referat bzw. Hausarbeit; b) Zug zu den Hunnen, Donauüberquerung
(Str. 1560-1579): Hagen und die Wandlungen seines Persönlichkeitsbildes in den Hss. B und C
11) 24.01.2011 Gastvortrag von Prof. Dr. em. Horst Brunner
über die mhd. Sangversepik und ihre Melodien: 16.15-17.00
Uhr; anschließend
Gastkonzert:
Das ‘Nibelungenlied’ in Ausschnitten dargeboten von Dr. Eberhard Kummer
(Bassbariton, Schoßharfe), 17:15-19:00
12) 31.01.2011 a) Kriemhild und die Wandlungen ihres Persönlichkeitsbildes in den Hss. B und C – Thema
für Referat bzw. Hausarbeit; b) Kriemhilds Rache und Tod, Lektüre,
Übersetzung und Interpretation der Str. 2423-2440 mit Bewertung der
unterschiedlichen "nôt"– und "liet"–Fassungen
(B und C)
13) 07.02.2011 a)
Mittelalterliche Rezeptionsgeschichte - Die "Nibelungenklage"
und ihre Bewertung von Geschehen und Handlungsträgern – Thema für Referat
bzw. Hausarbeit (Ausgabe: Mhd. Text mit Übers. und
Kommentar von E. Lienert. Paderborn 2000; b)
Lektüre, Übersetzung und Interpretation der Verse 3393-3484 der ‘Klage’)
ANMELDUNGEN
ZU REFERATEN BITTE PER EMAIL AN:
Sieglinde.Hartmann@germanistik.uni-wuerzburg.de
LITERATUR
BITTE AUCH
DIE MATERIALIEN ZUR VORLESUNG VOM SOMMERSEMESTER 2010 UNTEN AUF DIESER SEITE
BEACHTEN!
Textgrundlagen:
Das Nibelungenlied. Nach der Hs. C der Badischen Landesbibliothek
Karlsruhe. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Hrsg. und übersetzt von Ursula Schulze.
München: dtv 2008,
oder
Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch
/ Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor. Ins Nhd. übersetzt und kommentiert von Siegfried
Grosse. Stuttgart: Reclam 2002 u. ö. (mit KOMMENTAR, Literaturverzeichnis und
Nachwort!).
Musikalische
Neuaufführung des Epos:
Nibelungenlied. Complete Recording by Eberhard Kummer
on two MP3 CDs. The Chaucer Studio. Brigham Young University. USA 2007.
Altnordische Nibelungendichtungen:
Die Götter- und Heldenlieder der Älteren. Übersetzt.
kommentiert und hrsg. von Arnulf Krause. Stuttgart: Reclam 2004.
Nordische Nibelungen. Die Sagas von den Völsungen,
von Ragnar Lodbrok und Hrolf
Kraki. Aus dem Altnordischen übertragen von Paul
Hermann. Hrsg. von Ulf Diederichs. Köln 1985.
Die Geschichte Thidreks von Bern
(= Thidrekssaga). Übertragen von Fine Erichsen. Jena
1924. Nachdruck München 1996.
Internetausgabe
der Hs. Cmit Abbildungen sämtlicher Seiten, Transkriptionen +
Teilübersetzungen + Links): http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.htmlZum Vergleich: Das Nibelungenlied. Nach der St. Galler Handschrift (= Hs. B) hrsg. und erläutert
von Hermann Reichert. Berlin: W. de Gruyter Verlag 2005.
Sprachliche Hilfsmittel und Lexika
Matthias LEXER: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig 1872-1878. Nachdruck
Stuttgart 1979 (mit Belegstellen).
Matthias LEXER: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
Neueste Auflage. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.
Hermann
PAUL: Mittelhochdeutsche Grammatik. 24. Aufl. Neu bearb. von P. WIEHL und Siegfried GROSSE. Tübingen: M. Niemeyer Verlag 1998.
Sekundärliteratur:
Winder
McCONNELL (Hrsg.): A Companion
to the Nibelungenlied. Columbia 1998.
Die
Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hg. von Joachim Heinzle,
Klaus Klein und Ulrike Obhof. Wiesbaden 2003.
Jürgen BREUER (Hrsg.): Ze Lorse bi dem münster. Das Nibelungenlied (Handschrift C).
Literarische Innovation und politische Zeitgeschichte. München: Wilhelm Fink
Verlag 2006.
Otfrid EHRISMANN: Nibelungenlied. Epoche - Werk
- Wirkung. 2. Aufl. München 2002.
Otfrid EHRISMANN: Das Nibelungenlied. München
2005 (= C.H.BECK WISSEN 2372).
Christoph
FASBENDER (Hrsg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2005.
Volker GALLÉ
(Hrsg.) Siegfried. Schmied und Drachentöter. Worms 2005 (= Band 1 der
Nibelungenedition).
John GREENFIELD (Hrsg.): Das
Nibelungenlied. Actas de
Simpósio Internacional 2000. Porto 2001.
Edward
HAYMES: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München 1999 [= UTB
2070].
Joachim
HEINZLE: Das Nibelungenlied. Eine Einführung. Frankfurt a.M.
1994 [=Fischer TB 11843].
Joachim
HEINZLE: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005.
Werner
HOFFMANN: Das Nibelungenlied. 5. Aufl. Stuttgart 1982 [= Slg.
Metzler 7].
Victor
MILLET: Germanische Heldendichtung im Mittelalter. Eine Einführung. Berlin
2008.
Jan-Dirk
MÜLLER: Das Nibelungenlied. Berlin 2002 [= Klassiker-Lektüren 2] –Neueste,
überarbeitete Auflage!
Ursula
SCHULZE: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 [= Reclam Literaturstudium 17604].
Zur Überlieferung:
Klaus
Klein: Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften des Nibelungenliedes;
+ Lothar Voetz: Die Nibelungenlied-Handschriften
des 15. und 16. Jahrhunderts im Überblick; + Joachim Heinzle:
Die Handschriften des Nibelungenliedes und die Entwicklung des Textes;
alle 3 Beiträge in: Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hrsg. von Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ulrike Obhof.
Wiesbaden 2003.
_________________________________________________________________________________________
Sieglinde Hartmann –
Vorlesung Sommersemester 2010:
Die Wiederkehr der Mythen
I:
Die Nibelungen und das
‚Nibelungenlied’

Erste Seite der ältesten Handschrift C des
‚Nibelungenlieds’; Pergament, ca. 1230; Codex Donaueschingen 63; Badische Landesbibliothek
Karlsruhe
Vollständig digitalisiert aufzurufen unter dem link
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.html
(Mit Einführung und Handschriftenbeschreibung!
Edition dieser Fassung
von:
Ursula Schulze (Hg.), Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch /
Neuhochdeutsch. Hg. und übersetzt von U. S. (dtv 13693), München 2008 (nach
Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 63).
Inhalt und Zielsetzung der
Vorlesung
Am
31. Juli 2009 sind die drei ältesten Handschriften des Nibelungenlieds in das UNESCO Register des
Weltdokumentenerbes aufgenommen worden. Damit zählt das mittelhochdeutsche Epos zu den ersten mittelalterlichen
Dichtungen Europas, welche zum immateriellen Erbe der gesamten
Menschheit gehören. Worin liegt das
Geheimnis dieser außerordentlichen Faszinationskraft begründet? Wie
vergleichbare Heldenepen der Weltliteratur, so hat sich die Wirkung des Nibelungenlieds ebenfalls über
Sprachbarrieren und Epochengrenzen hinaus entfaltet. Dabei zeigt die
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Nibelungenlieds,
dass die Wertschätzung dieses Werks eng mit dem Wiederaufleben von Sagen und
Mythen aus heroischer Vorzeit zusammenhängt. Aus heutiger Sicht gilt das 12.
Jahrhundert als die erste nachantike Epoche, die durch eine Wiederkehr von
Mythen in Literatur und (höfischer) Kultur geprägt ist. In der Vorlesung sollen
daher epochenspezifische Fragen nach dem Wiederaufleben der Nibelungenmythen
erörtert werden: Worin unterscheidet sich die Stoffgestaltung im Nibelungenlied von den altnordischen
Nibelungendichtungen? Wie viel Mythisches bleibt in den Hauptgestalten des mhd.
Epos’ noch wirksam? Welche neue Sinngebung suggeriert die Neuordnung von
Handlung und Figurenkonstellation? Warum haben spätere, mittelalterliche wie
neuzeitliche Bearbeitungen wieder auf die älteren Heldenmuster zurückgegriffen?
Was lernen wir daraus für die weitgehend noch unerforschte periodische
Wiederkehr von Mythen?
Das
sind einige der Fragen, die in der Vorlesung erörtert werden sollen.
Gleichzeitig bietet die Vorlesung einen Überblick über die wesentlichen
Interpretationsprobleme, wie sie die aktuelle mediävistische Forschung zum Nibelungenlied beherrschen. Die
Vorlesung wendet sich an fortgeschrittene Studierende und setzt daher die
Kenntnis des Nibelungenlieds voraus.
Textgrundlagen:
Das Nibelungenlied.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut
de Boor. Ins Nhd. übersetzt und
kommentiert von Siegfried Grosse. Stuttgart: Reclam 2002 u. ö. (mit
Literaturverzeichnis und Nachwort!).
Ursula Schulze (Hg.), Das Nibelungenlied.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hg. und übersetzt von U. S. (dtv 13693),
München 2008 (nach Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 63).
Musikalische Neuaufführung des Epos: Nibelungenlied. Complete Recording by Eberhard
Kummer on two MP3 CDs. The Chaucer Studio. Brigham
Young University
Folgende
Sammelbände bieten die neueste Sekundärliteratur:
Ehrismann,
Otfrid: Nibelungenlied. Epoche - Werk - Wirkung. 2. Aufl. München 2002.
Fasbender,
Christoph (Hrsg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2005.
Gentry,
Francis G., McConnell, Winder, Müller, Ulrich and Wunderlich, Werner (Hrsg.): The
Nibelungen Tradition. An Encyclopedia. New York
John Greenfield (Hrsg.): Das Nibelungenlied. Actas
de Simpósio Internacional 2000. Porto 2001.
Haymes, Edward: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München 1999 [= UTB 2070].
Heinzle,
Joachim, Klein, Klaus and Obhof, Ulrike (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage – Epos –
Mythos. Wiesbaden 2003.
Heinzle,
Joachim: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005.
Jefferis, Sibylle (Hrsg.): The Nibelungenlied: Genesis, Interpretation, Reception (Kalamazoo
Papers 1997-2005). Göppingen: Kümmerle 2006.
McConnell, Winder (Hrsg.): A Companion to the Nibelungenlied. Columbia 1998.
Müller,
Jan-Dirk: Das Nibelungenlied. Berlin 2002 [= Klassiker-Lektüren 2] – neueste
überarb. Auflage!
Schulze, Ursula: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 (= Reclam
Literaturstudium 17604).
VORANKÜNDIGUNG FÜR DAS
WINTERSEMESTER:
Sieglinde Hartmann Hauptseminar WS 2010/2011
Mittelalterliche
Heldenepik: Das Nibelungenlied auf Basis der Hs. C
Vorlesungsplan - Mo
15.00-16.30, Hörsaal 2
1) 26. April 2010 –
Einführung: Die Wiederkehr antiker Mythen im 12. Jahrhundert, ihre Quellen,
Stoffkreise und das ‚Nibelungenlied’
2) 3. Mai 2010 – Das
‚Nibelungenlied’ im Kontext archaischer Heldendichtungen, seine Überlieferung
im deutschen Sprachraum und die Verbreitung des Nibelungenstoffs in
altnordischer Literatur
3) 10. Mai 2010 – Neues Heldenideal und neue Strophenform:
Kriemhilds Traum (1. Âventiure nach Hs. C) und das ‚Falkenlied’ des Kürenbergers (MF
I, 6-7)
4) 17. Mai 2010 –
Siegfrieds „minne” und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 280-307- Hs. C) - Einfluss des Minnesangs und
höfische Überformung des Stoffes
5) 31. Mai 2010 – Die
Brautwerbung um Brünhild auf Island (7. Âventiure) -- neuartige
Personencharakterisierung und Kunst dramatischer Handlungsführung
6) 7. Juni 2010 – Brünhilds
2. Brautnacht in Worms: Umfunktionierung mythischer Heldenepikmotive +
symbolische Kommunikation im ‚Nibelungenlied’
7) 14. Juni 2010 – Streit der Königinnen (Str.
834-850) - Peripetie der Haupthandlung?
8) 21. Juni 2010 – Ermordung Siegfrieds (Str. 978-998) –
Christliche Remythisierung der Gestalt Siegfrieds?
9) 28. Juni 2010 – Neue methodische Paradigmen und ihre Funktion
für die Deutung des 2. Teils des ‚Nibelungenlieds’
10) 5. Juli 2010 – Der
Untergang der Nibelungen: die Kontrahenten Hagen und Kriemhild und ihre
Remythisierung im ‚Nibelungenlied’ und bei Richard Wagner
Tischvorlage zur 10. Sitzung: Hagen im Nibelungenlied im Link
Tischvorlage zur 10. Sitzung: Kriemhild im Nibelungenlied im Link
MATERIALIEN ZUR VORLESUNG
Zu 1) 26. April 2010 –
Einführung: Die Wiederkehr antiker Mythen im 12. Jahrhundert, ihre Quellen,
Stoffkreise und das ‚Nibelungenlied’
Die
bedeutendsten Heldenepen der Weltliteratur, ihre mythischen Stoffe, ihre
Verschriftlichung und ihre periodische Wiederkehr
1) Gilgamesh-Epos
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
um 2500 v. Chr.; Titelheros: König Gilgamesh (Lebenszeit: um 2600 oder 2500 v. Chr.) = Begründer der
Stadt Uruq, Hauptstadt des altsumerischen Reiches.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos von
Gilgamesh: circa 1200 v. Christus
in einem Großepos in 12
sogenannten ‚Tafeln’ von rund 3000 Versen; Autor unbekannt = rund 1200
Jahre später.
2) Homers ‚Ilias’ und
‚Odyssee’ (Fall von Troja)
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
13. oder 12. Jahrhundert v. Chr.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos der
‚Ilias’ (= Fall von Troja = Ilion): circa 800 v. Christus in einem Großepos von 24 Büchern mit etwa
15000 Versen (= Hexametern); Autor: Homer, mehr als Name nicht bekannt =
rund 500-600 Jahre später.
c) Wiederkehr der trojanischen Mythen im
12. Jahrhundert (in afz. und mhd. Versionen) sowie nochmals 600-800 Jahre später
in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
3) Die ‚Aeneis’ des Römers Vergil (Gründung Roms)
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
um 800-700 v. Chr.: Gründung Roms: 753
v. Chr. = ab urbe condita der römischen Zeitrechnung.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos der ‚Aeneis’: 29-19 v. Chr. in 12 Gesängen von
9896 Hexametern (unvollendet) = rund 700 Jahre später.
c) Wiederkehr der Mythen von der
Gründung Romas im 12. Jahrhundert (in afz. und mhd. Versionen) sowie nochmals
600-800 Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
4) Das ‚Nibelungenlied’ und die
Dietrichepik des Hochmittelalters
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
Völkerwanderungszeit ca. 400-600 n. Chr.:
Untergang der Burgunden: 437 n.
Chr.; Untergang des Hunnenreichs und Tod Attilas: 453 n. Chr.; Theoderich der
Große (ca. 451-526 = Dietrich von Bern)): Blüte und Ende des Ostgotenreichs in
Italien.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos des
’Nibelungenlieds’: um 1200 n. Chr. in
38 bzw, 39 Âventiuren von rund 10000 Langversen = rund 600-700 Jahre später.
c) Wiederkehr der Nibelungen-Mythen
600-700 Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
5) Die mittelalterliche Artusepik
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
Völkerwanderungszeit ca. 400-600 n. Chr.:
Zusammenbruch der Römerherrschaft in Britannien; Artus = legendärer
Stammesführer, der das Reich Britannien im 5. oder 6. Jahrhundert
wiederhergestellt habe.
b) Verschriftlichung in höfischen
Romanen mit König Artus und seinen Rittern von der Tafelrunde in afrz. und mhd.
Versionen des 12. und 13. Jahrhunderts =
rund 500-600 Jahre später.
c) Wiederkehr der Artusmythen 600-700
Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
Zu 2) 3. Mai 2010 – Das
‚Nibelungenlied’ im Kontext archaischer Heldendichtungen, seine Überlieferung
im deutschen Sprachraum und die Verbreitung des Nibelungenstoffs in
altnordischer Literatur
The Nordic Nibelungen Tradition and its Main Sources
1)
Poetic Edda , Iceland
2) The Prose Edda of Snorri
Sturluson (1179-1241); Anthony Faulkes (Ed.): Edda by Snorri Sturluson: Prologue and
Gylfaginning (Oxford 1982) and Edda by Snorri Sturluson: Skáldskaparmál,
2 vols. (London London
3)
The Völsungasaga, Norway ca. 1250; R. G. Finch (ed., transl.) The Saga of the Volsungs. London 1965;
German translation: Nordische Nibelungen.
Die Sagas von den
Völsungen, von Ragnar Lodbrok und Hrolf Kraki. Aus dem Altnordischen übertragen
von Paul Hermann. Hrsg. von Ulf Diederichs. Köln 1985.
4) Thidrekssaga, Norway, ca. 1250; Henrik Bertelsen (ed.): Thidreks Saga af Bern. 2 vols.
Copenhagen 1905-1911; German translation: Die
Geschichte Thidreks von Bern. Übertragen von Fine Erichsen. Jena 1924.
Nachdruck München 1996.
Inhaltsunterschiede zwischen deutschem und
altnordischen Nibelungenstoff
Hauptgestalten: 3 königliche Familien und Brünhild
In der skandinavischen Nibelungentradition werden die
Burgunden stets ‚Niflungen’ genannt = ‚Nibelungen’
Das mittelhochdeutsche ‚Nibelungenlied’
1) Der Burgundenhof in Worms am Oberrhein
Königinmutter: Uote, Vater:
Dancrat
3
Söhne: Gunther, Gernot, Giselher + Schwester Kriemhild
Höchster Vassal: Hagen
(= Högni), Siegfrieds Mörder
2) Der Königshof der ‚Niederlande’ in Xanten am
Niederrhein
Königinmutter: Sieglinde,
Vater: Sigismund
1 Sohn: Siegfried = Kronprinz von Niederland, Herrscher über die
Nibelungen, wirbt um Kriemhild und heiratet sie
3) Der Hunnenhof in Etzelburg a.d. Donau
König: Etzel (= Attila),
heiratet Kriemhild in 2. Ehe, um
die êre, das Ansehen seiner Macht zu erhöhen.
4) Brünhild = Unbezwingbare jungfräuliche Königin von Îslant mit Isenstein als Hauptburg;
Brautwerber müssen 3
Freierproben bestehen, was nur Sioegfried gelingt (an Gunthers Stelle), daher
heiratet Brünhild Gunther
Die altnordische Tradition
1) Der Hof der Niflungen
Königinmutter: Grimhild,
Vater: Gjuki
3 Söhne: Högni, Gunnar,
Guthorm (= Sigurds Mörder) + Schwester
Gudrun
2) Der Hof König
Sigismunds
Königin: 2 Namen genannt:
Sisibe, Hjordis; 1 Name nicht erwähnt
1 Sohn: Jung Sigurd, der
Fafnir (= Drachen) Töter, erringt Nibelungenschatz,
liebt Brynhild, aber nach einem Vergessenstrank heiratet er Gudrun
3) Der Hunnenhof (unterschiedliche Orte in Nordwestdeutschland, u.a.
Soest)
König: Atli (= Attila)
heiratet in 2. Ehe Gudrun, Sigurds Witwe, um in den Besitz des Niflungenhorts zu gelangen
4) Brynhild = Walküre, Tochter von Odin (höchster Gott in anord. Mythologie), in einigen
Dichtungen ist sie Atlis Schwester, meist mit Sigurd verlobt, aber sie
heiratet Gunnar
Zu 3) 10. Mai 2010 – Neues Heldenideal und neue Strophenform:
Kriemhilds Traum (1.
Âventiure nach Hs. C) und das ‚Falkenlied’ des Kürenbergers (MF
I, 6-7)
Zu 4) 17. Mai 2010 –
Siegfrieds „minne” und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 280-307- Hs. C)
- Einfluss des Minnesangs und
höfische Überformung des Stoffes
Zu 5) 31. Mai 2010 – Die Brautwerbung
um Brünhild auf Island (7. Âventiure) -- neuartige Personencharakterisierung
und Kunst dramatischer Handlungsführung
Zu 6) 7. Juni 2010 –
Brünhilds 2. Brautnacht in Worms: Umfunktionierung mythischer Heldenepikmotive
+ symbolische Kommunikation im ‚Nibelungenlied’
Zu 7) 14. Juni 2010 – Streit der Königinnen (Str.
834-850) - Peripetie der Haupthandlung?
Zu 8) 21. Juni 2010 – Ermordung Siegfrieds (Str. 978-998) – Christliche Remythisierung der Gestalt Siegfrieds?
Sieglinde Hartmann SS 2010 VL :
Die Nibelungen und das “Nibelungenlied”
Handlungsstrukturen, Motive und Schauplätze im
Vergleich:
Siegfried/Sigurd (anord.), Brünhild + Kriemhild
(anord: Gudrun)
Ältere Edda
Snorris Prosa-Edda
Völsungensaga
Thidrekssaga
Nibelungenlied
Abstammung + Vorgeschichte:
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin)
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin)
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin)
Königsgeschlecht von Tarlungaland = in Schwaben?
Königsgeschlecht von
“Niederland” am Rhein
Eltern:
Vater: Siegmund, Mutter: namenlos
Vater: Siegmund, Mutter:
Hjördis
Vater: Siegmund, Mutter:
Hjördis
Vater: Siegmund, Mutter: Prinzessin
Sisibe von Spani-
en
Vater: Siegmund, Mutter: Sieglinde,
Residenz: Xanten
Geburt, Jugend + Erziehung
Als Ziehsohn beim Schmied
Regin, Ort: am Rhein
Als Ziehsohn des Schmieds
Regin am Hof König Hjalpreks (= Hjördis 2. Gatte) in Dänemark
Am Hof König Hjalpreks (=
Hjördis 2. Gatte) in Däne-
Mark mit Regin als Erzieher
Die unschuldig verstoßene
Sisibe gebiert Sigurd im Wald, Aussetzung des Kindes im Glasgefäß; Errettung
durch Hindin, Auffinden durch Schmied Mime, Erziehung zum Schmied
Königlich ritterliche
Erziehung am Xantener Hof
1. Heldentat = Drachentöter
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Gnitaheide
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Gnitaheide
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Heide
Tötung des Drachens (=
Mimes Bruder) im Wald
Nur indirekt in Hagens
Bericht er-
wähnt
2. Wunder = Drachenblut
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung
Berührung mit Brühe aus Drachenfleisch
= Verständnis der Vogelsprache +
Vogelweissagung + Erlangung einer Hornhaut durch Bestreichen mit Drachenblut
Nur indirekt in Hagens
Bericht er-
wähnt :
Erlangung einer Hornhaut
durch Bad im Drachen-
Blut; verwundbare Stelle
durch Lindenblatt zwischen Schulterblättern
3. Heldentat = Erbeutung des
Nibelungen-
horts
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts
NICHT DARGESTELLT
Nur indirekt in Hagens
Bericht er-
wähnt :
Erbeutung des
Nibelungenhorts durch Töten der Brüder Niflung + Schilbung
4. Heldentat = Erlösung Brünhilds
(= Walküre, von Odin zur Strafe für Ungehor-
sam in Schlaf auf Berg/Burg
gebannt)
S. überwindet Schildwall auf
Berg Hindarfjall u. zerschneidet die Brünne der Sigrdrifa (= Name für
Brünhild) + Variante im “Jüngeren Sigurdlied”: Brünhild = Schildmaid +
Schwester des Hunnenkönigs Atli
S. reitet zum Haus auf Berg
u. erweckt die Walküre Brünhild durch Zerschneiden der Brünne
S. reitet zum Berg
Hindarfjall, südwärts im Frankenland, u. erweckt die Schildjungfrau +
Königstochter Brünhild durch Zerschneiden der Brünne, sie schwören sich ewige
Liebe + nach weiteren Abenteuern
2. Wiedersehen mit Br. + 2.
Liebesschwur + Weissagung der Ehe mit Gudrun
S. reitet zu Brünhilds Burg,
um Hengst Grane aus ihrem Gestüt zu holen
(Später heißt es, Sigurd +
Brünhild hätten sich bereits bei ihrem 1. Treffen eidlich verbunden)
Nicht dargestellt, aber
frühere Begegnung mit Brünhild stillschweigend vorausgesetzt
5. Station: Hof der
Burgunden, Namen der Königsfamilie
Burgunden = Niflungen,
Vater: Gjuki,Mutter: Grimhild; Söhne:
Gunnar, Högni, Gotthorm, Schwester: Gudrun
Niflungen, Vater:
Gjuki, Mutter: Grimhild; Kinder:
Gunnar, Högni, Gudrun, Gudny; Gotthorm = Gjukis Stiefsohn
Niflungenhof, südlich am
Rhein, Vater: Gjuki,Mutter: Grimhild;
Kinder: Gunnar, Högni, Gutthorm, Gudrun
Mit König Thidrek ins
Niflungenland, König: Gunnar, Brüder:
Högni + Gernoz, Schwester: Grimhild; Resi-
denzstadt: Werniza
Burgunden in Worms am Rhein,
Vater: Dankrat, Mutter: Uta; Kinder:
Gun-
ther, Gernot, Gisel-
her, Kriemhild
6. Wunder: Vergessens-
trank
Königinmutter Grimhild
löscht Erinnerung an Brünhild aus
7. Liebe zur burgundischen Prinzessin
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau aufgrund des Vergessenstranks
Sigurd erhält Grimhild zur
Frau
Fernliebe zu Kriemhild von
Anbeginn aufgrund ihres höf. Wesens, ihrer Schönheit + Tugend
8. Verhältnis zu König
Gunther
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
“triuwe” - kein Eid
9. Verhältnis zu Hagen
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
10. Brautwerbung um
Brünhild für Gunther, Erfolg durch Siegfrieds Täu-
schungsma-
növer
Sigurd überwindet
Schildwall, erlöst Brünhild, vollzieht aber nicht das Beilager
Täuschungsmanöver:
Gestaltentausch; Sigurd reitet für Gunnar durch Waberlohe, vollzieht nicht
das Beilager, aber tauscht mit Brynhild Ringe (Andwaris Ring aus
Nibelungenhort = Morgengabe für B.)
Täuschungsmanöver:
Gestaltentausch; Sigurd reitet für Gunnar durch Waberlohe, vollzieht nicht
das Beilager, aber tauscht mit Brynhild Ringe (Sigurd nimmt B. den Ring
Andwaris + gibt ihr einen anderen Ring
aus Nibelungenhort)
Brautwerbung um B. (=
Königin der Stadt Seegard in Schwaben) für Günther durch Gespräch und
Beratung mit den Königen Thidrek + Gunnar; Brünhild willigt schließlich ein
Brautwerbung um Königin
Brünhild für Gunther, Siegfried täuscht B. mit Standeslüge + bezwingt sie im
Wettkampf mithilfe des Tarnmantels
11. Ehe von Kriemhild und
Siegfried
glücklich
2 Kinder: Sigmund +
Svanhild
1 Kind: Svanhild
Glücklich: 1 Sohn: Gunther
12. Ehevollzug von Brünhild
und Gunther nach Siegfrieds 2. Täuschungs-
manöver
Brünhilds Ehe = “Unheil”,
von Nornen vorherbestimmt
Nach Brünhilds + Gunnars
Hochzeit erinnert sich Sigurd an seine Liebesschwüre
Sigurd bezwingt Brünhild in
der 2. Brautnacht mithilfe eines Kleidertauschs, entjungfert sie + Ringtausch
Siegfried bezwingt Brünhild
in der 2. Brautnacht mithilfe der Tarnkappe, entwendet ihr Ring + Gürtel, entjung-
fert sie jedoch nicht
13. Brünhilds “nít”
Brünhild neidet Gudrun den
Gatten, weil sie nur ihn liebt
NICHT DARGESTELLT
NICHT DARGESTELLT
NICHT DARGESTELLT
Brünhild unglücklich aus Neid
auf Kriemhild + aus Verdacht, betrogen worden zu sein; daher hinterlistige
Einla-
dung nach Worms
14. Zerwürfnis der
Königinnen
Beim Haarewaschen im Fluss
provoziert Brynhild Gudrun: Gunnar sei der kühnere Held, weil er die
Waberlohe durchritten habe; Gudruns Antwort: Vorzeigen des Rings Andvaranaut
als Beweis für Sigurd als B.”s Bezwinger
Beim Baden im Fluss
provoziert Brynhild Gudrun: Gunnar sei der kühnere Held, weil er die
Waberlohe durchritten; Gudruns Antwort: Vorzeigen des Rings als Beweis für
Sigurd als B.”s Bezwinger; B. entdeckt den Betrug an ihr + an Sigurd
Brünhild provoziert Grimhild
zum Rangstreit in der Königshalle, Grimhilds Antwort: Vorzeigen des Rings als
Beweis dafür, dass Sigurd B.”s
bezwungen + entjungfert hat
Brünhild provoziert Kriemhild
zum Rangstreit auf der Treppe zum Wormser Münster; Kriemhilds Ant-
wort: Siegfried sei ihr
Bezwinger gewesen, Vorzei-
gen von Ring + Gürtel als
Beweise dafür, dass Siegfried B.
entjungfert hat
15.Brünhild = Anstifterin
zum Mord an Siegfried
Da sie Sigurd nicht haben
kann, muss er sterben
Betrug an Brynhild = Motiv
für S.”s Ermordung
Betrug an B. = Motiv für
S.”s Ermordung
Rache für öffentliche
Entehrung = Motiv für S.”s Ermordung
Rache für öffent-
liche Entehrung = Motiv für
S.”s Ermordung
16. Ermordung des unbewaff-
neten Sieg-
frieds
a) Mörder
Ältere Edda
Anstifterin : Brünhild, ausführender
Mörder: Gotthorm; Eidbrüchig:
Gunnar; Högni widerrät, aber
widersetzt sich nicht; daher alle 3 = Mörder
Prosa-Edda
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Gotthorm;
Eidbrüchig: Gunnar + Högni = 3 Mörder
Völsungensaga
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Gotthorm;
Eidbrüchig: Gunnar; Högni widerrät,
aber widersetzt sich nicht; daher alle 3 = Mörder
Thidrekssaga
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Högni mit Gunnars
Einverständnis
Nibelungenlied
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Hagen mit
Gunthers Billigung
17. Siegfrieds Ermordung
b) Schauplatz
“südlich am Rhein” im Wald
oder im Bett, Ed. A. Krause, S.354 + 357
Im Schlaf im Bett
Im Schlaf im Bett
Im Wald auf der Jagd bei
einer Rast ersticht Högni den trinkenden Sigurd von hinten zwischen den
Schulterblättern mit Sigurds Speer
Auf der Jagd auf einer
bewaldeten Rheininsel vor dem Odenwald; bei der Rast ersticht Hagen den trinkenden Siegfried von hinten
zwischen den Schulterblät-
tern mit dessen Speer
18. Brünhilds Ende
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche + “Helfahrt”
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche
Nicht dargestellt
19. Kriemhilds Rache + Ende
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Ende: Tod aller aus Rache für den Mord an ihren Brüdern
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Ende: Tod aller aus Rache für den Mord an ihren Brüdern
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Atli lädt Högni + Gunnar ein, aus Gier nach dem Hort + um
seine Schwester (= Brynhild) zu
rächen; Ende: Tod aller Hunnen, Gudrun überlebt + verheiratet sich zum 3. Mal
(mit König Jonakr)
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), sie lädt Högni + Gunnar ein, um Sigurds Ermordung zu rächen; Ende: Tod aller Hunnen +
Niflungen, Gudrun wird von Thidrek erschlagen
Kriemhild vermählt sich zum
2. Mal (mit Etzel), sie lädt ihre 3 Brüder + Hagen ein, um Siegfrieds Ermor-
dung zu rächen; Ende: Tod vieler Hunnen + aller Nibelungen,
Kriemhild wird von Hildebrand in Stücke gehauen
Ältere Edda
Prosa-Edda
Völsungensaga
Thidrekssaga
Nibelungenlied
Zu 9) 28. Juni 2010 – Neue methodische Paradigmen und ihre Funktion für die Deutung des 2. Teils des ‚Nibelungenlieds’
Zu 10) 5. Juli 2010 – Der
Untergang der Nibelungen: die Kontrahenten Hagen und Kriemhild und ihre
Remythisierung im ‚Nibelungenlied’ und bei Richard Wagner
Material zur 3. Sitzung
Material zur 4. Sitzung
Material zur 5. Sitzung
Material zur 7. Sitzung
Material zur 7. Sitzung
Material zur 8. Sitzung - Teil a
Material zur 8. Sitzung - Teil b_1
Material zur 8. Sitzung - Teil b_2
Material zur 9. Sitzung - Teil 1
Material zur 9. Sitzung - Teil 2
Aktuelle Seminarpläne
Prof. Dr. Sieglinde Hartmann –
Hauptseminar SS 2013
Oswald von
Wolkenstein (ca. 1376/77-2.8.1445)
Zeit: Montags
16.00-18.30, Ort: Phil-Geb. ÜR 24
S E M I N A R P L A
N
1) 21. Oktober - Einführung und
Themenvergabe
2) 28. Oktober – Autobiographische Lyrik:
Begriffsbestimmung, Lektüre, Übersetzung + Interpretation von Kl 18 (Sprecherrollen, Signalwörter, Dechiffrierung
der Bildsprache, Visualisierungsstrategien, Komik und Ironie)
3) 04. November – Das neue Genre der
(autobiographischen) Reiselieder (Kl 19, Kl 41 + 44) - mit Gastvortrag von Prof. Dr. Danielle Buschinger
(Amiens): Wolkensteins politische und moral-didaktischen Lieder und ihre
Bezüge zur Sangspruchdichtung
4) 11. November – Wolkensteins politische Lyrik (Kl 85, Kl
27 + 113)
5) 28. November – Wolkensteins Liebeslyrik
(1): Tagelieder (Kl 101, 48, 33)
6) 25. November – Wolkensteins Liebeslyrik
(2): Dialoglieder (Kl 43 + 79, Kl 71 + 77)
7) 02. Dezember – Wolkensteins Liebeslyrik
(3): Pastourellen und Schäferdichtung (Kl 78 +
83, Kl 92 und das ‚Kuhhorn’ des Mönchs von Salzburg)
8) 09. Dezember – Wolkensteins neuartige
Naturbilder: die autobiographischen ‚Hauensteinlieder’ (Kl 104, Kl
116) und die Frühlingslieder Kl 42 + 50
9) 16. Dezember – Weltenlust (Trinklieder Kl
54, 70, 84) und Weltverneinung (Weltabsagelieder Kl 9 + 11)
10) 13. Januar – Wolkensteins
autobiographische Lieder über seine Gefangenschaften (Kl 55, 59 + 26; Kl 1
+ 7)
11) 20. Januar – Todesfurcht in Wolkensteins
autobiographischen Liedern Kl 23 + 6 – mit Gastvortrag P. Winfried Schwab OSB, Subprior des Benediktinerstifts Admont und Präsident der österreichischen Totentanzvereinigung zum Thema: ‘Oswald von Wolkenstein und das Phänomen der Totentänze’.
12) 27. Januar – Wolkensteins geistliche Lieder:
Marienlieder
13) 01. Februar - Wolkensteins Religiosität:
Beichtlied KL 39 und Höllenlied Kl 32 - ENTFÄLLT!
Vortragszeit des mündlichen
Referats: 20-30 Minuten + 10 Minuten Diskussion; Umfang der schriftlichen
Ausarbeitung: max. 15 DinA4-Seiten + Bibliographie. – Die Interpretation
eines Liedes umfasst: Übersetzung, metrisches Schema, Einordnung in
Gattungstradition oder biographischen Kontext, Analyse von Inhalt und Form
unter dem vorgegebenen Aspekt und in Auseinandersetzung mit der
einschlägigen Sekundärliteratur; wenn möglich mit
Vorführung einer Einspielung oder eigenem Gesangsvortrag.
Achtung: die
Kenntnis der Biographie Oswalds von Wolkenstein ist Voraussetzung zur Teilnahme
am Seminar!
Textgrundlage:
Die Lieder Oswalds von Wolkenstein. Unter Mitwirkung von
Walter Weiss und Notburga Wolf hrsg. von Karl Kurt Klein. Musikanhang von Walter Salmen. Tübingen 1962, 3.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage von Hans Moser, Norbert Richard Wolf
und Notburga Wolf. Tübingen
1987 (= Altdeutsche Textbibliothek 55) =
wissenschaftliche Standardausgabe, zitiert: Kl + Liednummer.
Ohne Variantenapparat stehen alle
Texte der Klein’schen Ausgabe auf der Homepage der Oswald von
Wolkenstein-Gesellschaft kostenlos abrufbereit: http://www.wolkenstein-gesellschaft.com
Zur
Anschaffung empfohlene Teilausgabe:
Oswald von
Wolkenstein. Lieder. Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählte
Texte herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Burghart Wachinger. Melodien und Tonsätze
von Horst Brunner. Stuttgart:
Reclam Verlag 2007 (= UB 18490).
FOLGENDE
TITEL bzw. BIBLIOGRAPHISCHEN HILFSMITTEL GELTEN FÜR ALLE SITZUNGEN:
Josef SCHATZ: Sprache und Wortschatz der
Gedichte Oswalds von Wolkenstein. Wien und Leipzig 1930 (= Akademie der
Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 69,2).
Verskonkordanz zu den
Liedern Oswalds von Wolkenstein.
Hrsg. von George F. JONES, Hans-Dieter MÜCK und Ulrich MÜLLER. 2 Bde.
Göppingen 1973 (= G.A.G. 40/41).
Klaus J. SCHÖNMETZLER:
Oswald von Wolkenstein. Die Lieder mhd.-deutsch.
München 1979 [mit Rekonstruktion
aller Melodien!].
Burghart WACHINGER: Oswald von
Wolkenstein. Artikel in: Verfasserlexikon. 2. Aufl. Bd. 7. 1989. Sp. 134-169.
Werner MAROLD: Kommentar zu den
Liedern Oswalds von Wolkenstein. Hrsg. von Alan ROBERTSHAW. Innsbruck 1995 [Wichtige Erläuterungen zur Metrik!].
Anton SCHWOB: Oswald von
Wolkenstein. Eine Biographie. Bozen 1977.
Anton SCHWOB u.a. (Hrsg.): Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein,
Edition und Kommentar, 4 Bände. Wien, Köln 1999 / 2000 / 2004 / 2011
/ 2013.
Alan
ROBERTSHAW: Zur Datierung der Lieder Oswalds von Wolkenstein. In:
Rollwagenbüchlein. Fs. für W. Röll.
Hrsg. von Jürgen Jaehrling u.a.
Tübingen 2002, S. 107-135.
Ulrich
MÜLLER: "Dichtung" und "Wahrheit" in den Liedern
Oswalds von Wolkenstein: Die autobiographischen Lieder von den Reisen.
Göppingen 1968.
Sieglinde
HARTMANN: Oswald von Wolkenstein heute: Traditionen und Innovationen in seiner
Lyrik. In: JOWG Bd. 15 (2005), S. 349-372.
Johannes
SPICKER: Oswald von Wolkenstein. Die Lieder. Berlin 2007 (= Klassiker
Lektüren 10).
Sieglinde HARTMANN: Oswald von
Wolkenstein. Artikel in: Kindlers Literatur Lexikon. 3., völlig neu
bearbeitetet Auflage. Hrsg. von Heinz Ludwig ARNOLD. Stuttgart / Weimar 2009,
Band 12, S. 418-420.
Burghart
WACHINGER: Textgattungen und Musikgattungen beim Mönch von Salzburg und
bei Oswald von Wolkenstein. In: Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Berlin 2010, S.
385 – 406.
Oswald von Wolkenstein. Das
poetische Werk. Übers. von Wernfried HOFMEISTER.
Berlin u.a. 2011 [Sekundärliteratur
zu einzelnen Liedern, vor jeder Interpretation zu konsultieren!].
Ulrich MÜLLER / Margarete
SPRINGETH (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin u.a. 2011 [Forschungsbilanz mit vollständiger Bibliographie!].
Oswald von Wolkenstein im
Kontext der Liedkunst seiner Zeit. Hrsg. von Ingrid BENNEWITZ und Horst
BRUNNER: Wiesbaden 2013 (= JOWG Bd. 19).
__________________________________________________________________________
SS 2013
Prof. Dr. Sieglinde Hartmann:
Oswald von Wolkenstein und die deutsche Lyrik des Spätmittelalters
Sommersemester 2013
Wann?
Montags 16.00-18.00 Uhr Wo? Hörsaal 2
VORLESUNGSPLAN
1) 22. April 2013 – Einführung
2) 29.
April 2013 – Traditionen und Innovationen in den Liedern Oswalds von
Wolkenstein
3) 06.
Mai 2013 – Die Reisen des Ritters Oswald von Wolkenstein und seine
autobiographischen ‘Reiselieder’ Kl 18, 19 und 44
4) 13. Mai 2013 – Wolkensteins politische
Lyrik: Der Kampf um Greifenstein in Tirol (Kl 85) und Wolkensteins Beteiligung an den
Reichskreuzzügen gegen die Hussiten (Kl 27 + Kl 134)
5) 03. Juni 2013 – Wolkensteins Lebenswelt und seine neuartigen Naturbilder: Die Pastourelle Kl 83, die ‘Hauensteinlieder’ Kl 116 und Kl 104 sowie das Vogelstimmenkonzert Kl 505)
6) 10. Juni 2013 – Minnesangtradition und Innovation in Wolkensteins Liebesliedern: die Tageliedvariationen Kl 101, Kl 53, das Neujahrslied Kl 61 Gelück und hail und das Liebesduett Kl 77 “Simm Gredlin, Gret”
7) 17. Juni 2013 – Weltenlust und Weltverneinung: Carmina Burana (In taberna quando sumus) vs. Oswalds Trinklied Her wiert, uns dürstet also sere (Kl 70), Walther von der Vogelweide Fro Werlt vs. Oswalds O welt, o welt (Kl 9)
8) 24. Juni 2013 – Wolkensteins geistliche Lieder: Die neuartigen Text-Bild-Verhältnisse in Wolkensteins Marienliedern Kl 78, Kl 120 und Kl 34
9) 08. Juli 2013 – Wolkensteins Religiosität: Gefangenschaft, Folter, Todesangst und Höllenvorstellung Kl 1, Kl 6, Kl 7 und Kl 32)
Hier finden Sie
nachfolgend:
3. Kommentar
4. Sekundärliteratur (in
Auswahl der Vorlesungsthemata)
5. Diskographie
1. Textgrundlage
1.1 Standardausgabe
Die Lieder Oswalds von
Wolkenstein-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von Walter Weiss und Notburga Wolf
hrsg. von Karl Kurt Klein. Musikanhang von Walter Salmen. Tübingen 1962, 3.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage von Hans Moser, Norbert Richard Wolf und
Notburga Wolf. Tübingen 1987 u.ö. (= Altdeutsche Textbibliothek 55)
1.2 Alternative zur
Standardausgabe
Oswald von Wolkenstein: Lieder.
Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählte Texte hrsg., übers. und
kommentiert von Burghart Wachinger. Melodien und Tonsätze hrsg. und kommentiert
von Horst Brunner. Stuttgart 2007 (= RUB 18490).
Alle Texte zu Oswald von Wolkenstein stehen zum kostenlosen
Download auf der Homepage der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft bereit:
www.wolkenstein-gesellschaft.com/texte_oswald/php
Weiteres Material
stellt das Archiv
der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft
an der Karl-Franzens-Universität Graz zur
Verfügung. Dieses Grazer Wolkenstein-Archiv befindet sich in der
Nachlass-Sammlung der UB Graz und wird
seit der Emeritierung von Anton Schwob (2005) von Wernfried Hofmeister betreut.
Bereits online aufzurufen sind u.a.: der Bestand des Archivs, der Kommentar von Werner
Marold (1926) sowie die Gesamtedition der Melodien durch
Oswald Koller (1902).
2. Gesamtübersetzung
Oswald
von Wolkenstein: Das poetische Werk. Gesamtübersetzung in neuhochdeutsche Prosa
mit Übersetzungskommentaren und
Textbibliographien von Wernfried Hofmeister. Berlin: De
Gruyter Verlag 2011.
3. Kommentar
Werner
MAROLD: Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein. Hrsg. von Alan
ROBERTSHAW. Innsbruck 1995 [Jetzt im Grazer
‘Wolkenstein-Archiv’ online aufzurufen – hier
klicken!]
4. Sekundärliteratur (Auswahl –
chronologisch)
MÜLLER, Ulrich: "Dichtung"
und "Wahrheit" in den Liedern OsvW: Die autobiographischen Lieder von
den Reisen. Göppingen 1968 (GAG 1).
SCHWOB, Anton: Oswald von Wolkenstein.
Eine Biographie. Bozen 1977.
SCHWOB, Anton u.a. (Hrsg.): Die
Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein, Edition und Kommentar, 4 Bände. Wien,
Köln 1999 / 2000 / 2004/ 2011.
HARTMANN, Sieglinde: Oswald von
Wolkenstein heute: Traditionen und Innovationen in seiner Lyrik. In: JOWG 15
(2005), S. 349-372.
SPICKER, Johannes: Oswald von
Wolkenstein. Die Lieder. Berlin 2007 (= Klassiker Lektüren 10).
HARTMANN, Sieglinde: Oswald von
Wolkenstein, in: Kindlers Literatur-Lexikon. 3., völlig neu bearbeitete
Auflage. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Stuttgart /Weimar 2009, Band 12,
418-420.
MÜLLER, Ulrich / SPRINGETH, Margarethe
(Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk – Rezeption. Berlin 2011 (mit
Gesamtbibliographie und Forschungsbericht).
HARTMANN, Sieglinde: Die deutsche
Liebeslyrik vom Minnesang bis zu Oswald von Wolkenstein oder Die Erfindung der
Liebe im Mittelalter. Wiesbaden 2012 (= Einführung in die deutsche Literatur
des Mittelalters, Band 1).
5. Diskographie
bzw. Einspielungen
SCHUBERT, Martin: Einspielungen von
Liedern Oswald von Wolkenstein. Mit einer Diskographie. In: MÜLLER, Ulrich /
SPRINGETH, Margarethe (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin 2011, 313-329.
Diskographie zusammengestellt von
Christine Müller auf:
http://www.wolkenstein-gesellschaft.com/diskographie.php

Unbekannter Maler, Oswald von Wolkenstein, Innsbrucker
Liederhandschrift von 1432, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Erstes
lebensechtes und lebensgroßes Porträt eines deutschsprachigen Autors
__________________________________________________________________________
Wintersemester 2012/13
Prof.
Dr. Sieglinde Hartmann
Hauptseminar
WS 2012/2013
Übungsraum
24 im Phil.-Gebäude
Zeit:
montags 16.00-19.00 Uhr, Beginn: 22.10.2012
Der 'Gregorius’ des
Hartmann von Aue und die Wiederkehr des Ödipusmythos
Bitte neuen Studienführer mit studienrelevanten Informationen inklusive Kursbeschreibungen auf der Homepage des Würzburger Instituts beachten:
Studiumsführer
Zu
den gelungensten Neuformungen antiker Mythenstoffe im Hochmittelalter
zählt Hartmanns Verserzählung von einem sagenhaften Papst Gregor
– obwohl der höfische Epiker seine Vorlage, die altfranzösische
Legende, ohne nachweisliche Kenntnisse des antiken Ödipus-Mythos aufgegriffen
hat. Gegenüber der antiken Form der Tragödie und dem damit eng
verbundenen Glauben an ein von Göttern verhängtes Schicksal
entwickelt der mittelalterliche Autor Erzählstrategien, welche es seinem
Protagonisten erlauben, einen für die Menschheit neuartigen Weg der
‚Katharsis’ zu finden.
Um
die Zusammenhänge von neuem christlichen Menschenbild und höfischer
Erzählkunst zu erfassen, werden wir Hartmanns ‚Gregorius’ aus
der Perspektive der Ödipus-Mythen der Antike in den Blick nehmen. Im
Gegenlicht der antiken Modelle werden wir sodann erarbeiten, wie der
mittelalterliche Epiker eine innere Umgestaltung der antiken Mythenmotive
erreicht. Unsere Hauptaufgabe wird es mithin sein zu erfragen, wie Hartmann von
Aue die Handlung strukturiert, wie er die Funktion der narrativen Instanz ausfüllt,
mit welchen erzählerischen Mitteln er das
Geschehen strukturiert und vorantreibt und wie er den Charakter seines
Titelhelden zu dem neuartigen ‚Heldentyp’ eines sündigen
Heiligen ausformt.
Textgrundlage:
Hartmann von Aue. Gregorius. Nach
dem Text von Friedrich Neumann neu herausgegeben, übersetzt und
kommentiert von Waltraud Fritsch-Rößler.
Stuttgart 2011 (Reclams UB 18764) - mit
neuester Sekundärliteratur,
oder
Hartmann von Aue. Gregorius. Der
Arme Heinrich. Iwein. Herausgegeben und
übersetzt von Volker Mertens. Frankfurt am Main 2008 (= Deutscher
Klassiker Verlag im Taschenbuch, Band 29) – ausführlichster Stellenkommentar
und aktualisierte Auswahl-Bibliographie.
Gregorius von Hartmann von Aue. Hrsg.
von Hermann Paul, neu bearbeitet von Burghart Wachinger.
15., durchgesehene und erweiterte Auflage. Tübingen 2004 – einsprachige Ausgabe mit wenigen
Erläuterungen, aber beste Übersicht über Überlieferung,
Seite VII-XV.
Quellen:
Hartmann von Aue, Gregorius. Die Überlieferung des Prologs, die Vaticana-Handschrift A und eine Auswahl der übrigen
Textzeugen in Abbildungen herausgegeben und erläutert von Norbert Heinze.
Göppingen 1974 (= Litterae Nr. 28) – schwarz-weiß-Faksimile
der Textüberlieferung.
Digitalisat der
Leithandschrift A in der
Apostolischen Bibliothek des Vatikan (Signatur: Rom, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Cod. Regin. Lat.
1354) aufrufbar über Nachweis in: Handschriftencensus.
Marburger Repertorium. Deutschsprachige Handschriften
des 13. und 14. Jahrhunderts:
http://www.fgcu.edu/rboggs/Hartmann/Gregorius/GrImages/GrGetImagesA.asp
Textausgabe
der altfranzösischen Vorlage:
La vie du pape Saint Grégoire ou
La Légende du bon pécheur. Leben des heiligen Papstes Gregorius
oder die Legende vom guten Sünder. Text nach der Ausgabe von Hendrik
Bastian Sol mit Übersetzung und Vorwort von Ingrid Kasten. München
1991 (= Klassische Texte des romanischen Mittelalters in zweisprachigen
Ausgaben 29).
Vollständige Bibliographien bzw. Monographien:
Elfried Neubuhr: Bibliographie zu Hartmann von Aue. Berlin 1976.
Hartmann
von Aue. Mit einer Bibliographie. Hrsg. von Petra Hörner. Frankfurt am
Main et al. 1998.
Christopf Cormeau und Wilhelm Störmer:
Hartmann von Aue. Epoche – Werk
– Wirkung. 3. Aufl. München 2007.
Jürgen Wolf: Einführung in
das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007 – nicht ohne Fehler, aber neueste Monographie.
Neuere
Sekundärliteratur zu mediävistischer Erzählforschung (Narratologie)
und zur literaturwissenschaftlichen Intertextualität:
Überblick
im Artikel „Narratologie“ in: Metzler Lexikon Literatur. 3. Aufl.
Stuttgart / Weimar 2007.
Ulrich
Broich: Intertextualität. In: Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung. Band 2. Berlin 2000, 175-179.
Gérard
Genette: Die Erzählung. 3., durchgesehene und korrigierte Auflage
übersetzt von Andreas Knop mit einem Nachwort
von Jochen Vogt überprüft und berichtigt von Isabel Kranz.
München 2010.
Wolfram-Studien XVIII.
Erzähltechnik und Erzählstrategien in der deutschen Literatur des
Mittelalters. Saarbrücker Kolloquium 2002. Hrsg. von Wolfgang Haubrichs, Eckart C. Lutz, Klaus Ridder.
Berlin 2004; darin Einleitung sowie
die folgenden Beiträge:
Monika Unzeitig: Von der
Schwierigkeit zwischen Autor und Erzähler zu unterscheiden. Eine
historisch vergleichende Analyse zu Chrétien
und zu Hartmann. In: Wolfram-Studien XVIII. Berlin 2004, 59-81.
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
Monika
Unzeitig: Autorname und Autorschaft: Bezeichnung und Konstruktion in der
deutschen und französischen Erzählliteratur des 12. und 13.
Jahrhunderts. Berlin/New York 2010.
Historische
Narratologie – Mediävistische Perspektiven. Hrsg. v. Haferland,
Harald / Meyer, Matthias. Berlin/New York 2010.
Armin
Schulz: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. Berlin/New York
2012.
Neuere
Sekundärliteratur zur literaturwissenschaftlichen und zur
mediävistischen Mythosforschung:
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008.
Band
1: Herrscher Helden Heilige; darin Einleitung, sowie ARTIKEL zu Karl der
Große, Sankt Georg, Der Heilige Franz von Assisi; Band 2: ARTIKEL zum
Teufel; Band 3: ARTIKEL Judas Ischariot.
ARTIKEL
‚Mythologie’ und ‚Mythos’, in:
Metzler Lexikon Literatur. 3. Aufl. Stuttgart / Weimar 2007 (= grundlegende literaturwissenschaftliche
Definition).
Neuere
Sekundärliteratur zur Diskussion über Helden und Heilige:
Bernd
Bastert: Helden als Heilige. Chanson de geste-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Tübingen
2010 (besonders: Vorwort).
Helden
und Heilige: kulturelle und
literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Hrsg. von
Andreas Hammer. Heidelberg 2010 (besonders:
Vorwort) sowie darin
Jing Xuan: Erzählen im Schwellenraum: Die Legende des
sündigen Hl. Grégoire, Seite 197-214.
Ulrich
Müller: Heldenbilder der Antike und des europäischen Mittelalters:
Eine tour d’horizon. In: Das Nibelungenlied und das Buch des Dede
Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des
zweiten interkulturelles Symposiums in Mainz,
Deutschland, 2011. Herausgegeben von Kamal M. Abdullayev, Hendrik Boeschoten
und Sieglinde Hartmann . Reichert
Verlag Wiesbaden 2013 (in Vorbereitung, elektronisch zur Verfügung
gestellt).
Im Folgenden verweise ich
nur auf die wichtigsten (neueren) Titel, weitere Sekundärliteratur muss
selbst zu dem betreffenden Thema recherchiert werden!
Sitzungsplan
1) 22.10.2012 – Einführung, Erläuterung des
Seminarplans, Verteilung der Referate / Hausarbeiten
2) 29.10.2012
– Hartmanns
Prolog, die afz. Vorlagen und die Gattungsproblematik
Themen:
a) Die afz. Vorlagen zu Hartmanns
‚Gregorius’, die Überlieferung von Hartmanns
‚Gregorius’ und die bisherigen Versuche der Gattungsbestimmung
Sekundärliteratur:
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007, dort bibliogr. Nachweise;
Zusammenfassung
der Diskussion im Vorwort der Ausg. der afrz. Legende
von I. Kasten sowie Nachwort der Ausgaben von W. Fritsch-Rößler
+ V. Mertens;
Fritz
Peter Knapp: legenda aut
non legenda. Erzählstrukturen und
Legitimationsstrategien in ‚falschen’ Legenden des Mittelalters:
Judas – Gregorius – Albanus. In: Germanisch-Romanische
Monatsschrift. 53. 2003, 133-154.
b)
Der Prolog des ‚Gregorius’: Inhaltlicher Aufbau, rhetorische
Gestaltung und narrative Funktion
Sekundärliteratur:
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007 –
dort Erläuterungen + Literaturhinweise + Kommentare in den Editionen von Fritsch-Rößler und Mertens.
3) 05.11.2012
– Die Handlungsstruktur des ‚Gregorius: Antike
und mittelalterliche Muster einer Heldenbiographie
Themen:
a) Der Ödipus-Mythos von der griechischen Antike bis zum Mittelalter
– eine stoffgeschichtliche Zusammenfassung
Sekundärliteratur:
Artikel
ÖDIPUS in: Elisabeth Frenzel: Stoffe der
Weltliteratur. 10. Aufl. Stuttgart 2005.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
Mythos Ödipus. Texte von Homer bis
Pasolini. Hrsg. von Nikola Rossbach. Leipzig 2005 – Textsammlung mit
Erläuterungen.
b) Heilige
Helden des Mittelalters und ihre Gestaltung in der deutschen Literatur des
Mittelalters: Karl der Große (‚Rolandslied’ des Pfaffen
Konrad), Hl. Gregorius (Hartmann von Aue) und Hl. Georg (Konrad von
Würzburg)
Sekundärliteratur:
Ulrich Wyss: Legenden, in: Epische Stoffe des Mittelalters. Hrsg.
von Volker Mertens und Ulrich Müller. Stuttgart 1984;
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 1: Herrscher Helden Heilige; darin Einleitung, sowie
ARTIKEL zu Karl der Große, Sankt Georg.
Bernd
Bastert: Helden als Heilige. Chanson de geste-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Tübingen
2010 (besonders: Vorwort).
Ulrich
Müller: Heldenbilder der Antike und des europäischen Mittelalters:
Eine tour d’horizon. In: Das Nibelungenlied und das Buch des Dede
Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des
zweiten interkulturellen Symposiums in Mainz,
Deutschland, 2011. Herausgegeben von Kamal M. Abdullayev, Hendrik Boeschoten
und Sieglinde Hartmann . Reichert
Verlag Wiesbaden 2013 (in Vorbereitung, elektronisch zur Verfügung
gestellt).
4) 12.11.2012
– Der Handlungsbeginn im ‚Gregorius’ und die Rolle des
Erzählers
Themen:
a)
Die Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler in den Erzählwerken
Hartmanns von Aue: ‚Erec’, ‚Iwein’, ‚Gregorius’ und ‚Armer
Heinrich’
Sekundärliteratur:
Monika
Unzeitig: Von der Schwierigkeit zwischen Autor und Erzähler zu
unterscheiden. Eine historisch vergleichende Analyse zu Chrétien
und zu Hartmann. In: Wolfram-Studien XVIII. Berlin 2004, 59-81.
b)
Die Funktion des Erzählers in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Cornelia
Johnen: Analyse der narrativen Funktion des Erzählers in Hartmanns von Aue
‚Gregorius’. München 2011 (Online-Ressource).
5) 19.11.2012 – Inzestgeburt
des ‘neuen’ Helden: die Eltern zwischen Selbstbestimmung und
Fremdbestimmung – Vers 451-500
Themen:
a)
Inzest im mittelalterlichen Recht und in den mittelalterlichen Legenden von den
Inzest-Heiligen Metro von Verona, Albanus und Gregorius
Sekundärliteratur:
Artikel
INZEST in: Elisabeth Frenzel: Motive der
Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
Artikel
INZEST in Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte + Lexikon des
Mittelalters.
Alexandra
Rassidakis: Von Liebe und Schuld. Inzest in Texten
von Hartmann von Aue, Th. Mann und Jeffrey Eugenides.
In: literatur für leser.
2005, 65-84.
b)
Gestaltung des Geschwisterinzests in der afz. ‚Vie
du pape saint Grégoire’ und in Hartmanns
‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte
Herlem-Prey: Le ‚Gregorius’ et la
‚Vie de Saint Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen 1979.
Alexandra
Rassidakis: Von Liebe und Schuld. Inzest in Texten
von Hartmann von Aue, Th. Mann und Jeffrey Eugenides.
In: literatur für leser.
2005, 65-84.
6)
26.11.2012 – Aussetzung des Kindes in antiken
Ödipusmythen, in der
Bibel, in den altnordischen Siegfriedsagen und bei
Hartmann – Vers 924-938 + 1008-1033
Themen:
a)
Aussetzung des Kindes in antiken Ödipus-Mythen, in der Bibel (Moses), in
römischen Mythen von Romulus und Remus und in der ‚Thidrekssaga’ (Sigurd/Siegfried)
Sekundärliteratur:
Artikel
HERKUNFT, Die unbekannte in: Elisabeth Frenzel:
Motive der Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
FitzRoy Richard Somerset Raglan: The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama. London
Materialen
zu meiner Vorlesung mit vergleichender Motivtabelle Ödipus –
Gregorius.
b)
Die Aussetzung des Kindes in der afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’
und in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Joachim
Theisen: Des Helden bester Freund. Zur Rolle Gottes bei Hartmann von Aue,
Wolfram und Gottfried. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches in
geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 153-169.
Hausmann,
Albrecht: Gott als Funktion erzählter Kontingenz: Zum Phänomen der
„Wiederholung“ in Hartmanns von Aue ‚Gregorius. In: Kein
Zufall: Konzeptionen von Kontingenz in der
mittelalterlichen Literatur. Hrsg. von Cornelia Herberichs.
Göttingen 2010, 79-109
7) 03.12.2012 – Gregorius’
Jugend und die Entdeckung seiner
Findlingsherkunft: Einbruch
neuer mythischer Motive? Vers 1285-1335 + 1359-1374
Themen:
a) Muster von Kindheit und Jugend in Hartmanns ’Gregorius’,
in Gottfrieds ‚Tristan’ und in Wolframs ‚Parzival’
Sekundärliteratur:
Matthias
Winter: Kindheit und Jugend im Mittelalter. Freiburg i.Br. 1984.
Madeleine Pelner
Cosman: The Education of the Hero in Arthurian Romance.
Chapel Hill 1965.
David A. Wells: Fatherly Advice. The Precepts of ‘Gregorius’, Marke, and Gurnemanz and the
School Tradition of the (Disticha Catonis’.
(…).
In: Frühmittelalterliche Studien. 28. 1994, 296-332.
b) Heldenjugend und Entdeckung der Findlingsherkunft im antiken
Ödipus-Mythos, in der mittelalterlichen Judaslegende, in Hartmanns
‚Gregorius’ und ihre Funktion im Handlungsverlauf
Sekundärliteratur:
Artikel
HERKUNFT, Die unbekannte in: Elisabeth Frenzel:
Motive der Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, 165-199.
8) 10.12.2012 – Das Streitgespräch zwischen dem Abt und Gregorius und
die 1. Ausfahrt des Helden Vers 1385-1850
Themen:
a)
Die mittelalterliche Gattung des Streitgesprächs und die Struktur des
Streitgesprächs zwischen Abt und Gregorius bei Hartmann
Sekundärliteratur:
Paul
Michel: Mit Worten tjôstieren. Argumentationsanalyse
des Dialogs zwischen dem Abt und Gregorius bei Hartmann von Aue. In:
Germanistische Linguistik. 1979, 195-215.
Anja
Becker: Die göttlich geleitete Disputation: Versuch einer
Neuinterpretation von Hartmanns ‚Gregorius’ ausgehend vom Abtgespräch. In: Disputatio
1200-1800: Form, Funktion und Wirkung eines
Leitmediums universitärer Wissenskultur. Hrsg. von Marion Gindhart und Ursula Kundert. Berlin/New
York 2010, 331-361.
b)
Die Bewertung der ritterlichen Lebensform aus Sicht des Abtes und aus Sicht des
Gregorius in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Hans-Georg
Reuter: Die Lehre vom Ritterstand. Zum Ritterbegriff in Historiographie und
Dichtung vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. 2. Aufl. Köln, Wien 1974.
Kerstin
Schmitt: Körperbilder, Identität und Männlichkeit im ‚Gregorius’.
In: Genderdiskurse und Körperbilder im
Mittelalter. (…). Hrsg. von Ingrid Bennewitz
und Ingrid Kasten. Münster 2002, 135-155.
9) 17.12.2012 – Gregorius’ 1. Begegnung mit der
Mutter und seine 1. Heldentat; Heirat und inzestuöses Eheleben –
Vers 1894-2518
Themen:
a)
Das Motiv des Sehens und die narrative Fokalisierung in der 1. Begegnungsszene
mit Mutter und Sohn
Sekundärliteratur:
Artikel
QUINQUE LINEAE AMORIS, in: Sachwörterbuch der Mediävistik. Hrsg. von
Peter Dinzelbacher. Stuttgart 1992.
Gerhard
Wolf: Sieht man mit dem ‚inneren Auge’ besser? Zu Formen und
Funktion visueller Wahrnehmung im mittelniederländischen ‚Roman van Walewein’. In: Sehen und Sichtbarkeit in der
Literatur des deutschen Mittelalters. XXI. Anglo-German
Colloquium London 2009. Hrsg. von Ricarda Bauschke,
Sebastian Cox, Martin H. Jones. Berlin 2011, 211-227.
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
b)
Erste Heldentat und der Mutter-Sohn-Inzest im antiken Ödipus-Mythos, in der
afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’ und
in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
10)
07.01.2013 – Die
Entdeckung des Inzests, die biblischen Beispielfiguren
(Judas und
König David), die Buße der Mutter und die Trennung des Paares
– Vers 2519-2747
Themen:
a) Die narrative Funktion der biblischen Beispielfiguren bei der
Entdeckung des Inzests im Kontext der extradiegetischen
Bemerkungen in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Ulrich Ernst: Der
‚Gregorius’ des Hartmann von Aue. Theologische Grundlagen – legendarische Strukturen – Überlieferung im
geistlichen Schrifttum. Köln 2002.
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 3: ARTIKEL Judas Ischariot.
Hartmut Freytag: „diu seltsaenen maere / von dem guoten sündaere“. Über die heilsgeschichtlich
ausgerichtete interpretatio auctoris
im ‚Gregorius’ Hartmanns von Aue. In: Euphorion.
98. 2004, 265-281.
b) Die Funktion des Teufels bei den Inzesten in der afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’ und
in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Arnold
Angenendt: Geschichte der Religiosität im
Mittelalter. Darmstadt 1997, Kapitel „Engel und Teufel.
Ingrid
Kasten im Vorwort zur afz. Textausgabe.
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 2: ARTIKEL zum Teufel.
11)
14.01.2013 – Strafe
für den Inzest: Gregorius’ 2. Heldentat (Buße) und seine
Verwandlung in
einen Heiligen – Vers 2751-3144.
Themen:
a)
Gregorius’ 2. Ausfahrt und die narrative Gestaltung der Verwandlung in
einen Heiligen
Sekundärliteratur:
Peter
Strohschneider: Inzest-Heiligkeit. Krise und Aufhebung der Unterschiede in
Hartmanns ‚Gregorius’. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches
in geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 105-133.
Harald
Haferland: Metonymie und metonymische Handlungskonstruktion erläutert an
der Konstruktion von Heiligkeit in zwei mittelalterlichen Legenden. In: Euphorion. 99. 2005, 323-365.
b)
Verwandelt der Erzähler Gregorius tatsächlich in einen heiligen Eremiten?
Eine kritische Sichtung der Forschung, speziell von V. Mertens Monographie
Sekundärliteratur:
Erhard
Dorn: Der sündige Heilige in der Legende des Mittelalters. München
1967.
Peter
Strohschneider: Inzest-Heiligkeit. Krise und Aufhebung der Unterschiede in
Hartmanns ‚Gregorius’. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches
in geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 105-133.
12) 21.01.2013
– Gregorius’ Erwählung zum Papst und die Wunder seiner 2.
Auffindung: neues Heiligenideal – Vers 3137-3830
Themen:
a)
Die Funktion der Fischer als Handlungsträger in Hartmanns
‚Gregorius’
b)
Gregorius und sein neues Heiligenideal im Kontext der mittelalterlichen Heiligenverehrung
Sekundärliteratur:
Peter
Dinzelbacher / Dieter Bauer (Hrsg.): Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. Ostfildern
1990, 10-17.
Artikel
HEILIGE, in: Lexikon des Mittelalters.
Helden
und Heilige: kulturelle und
literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Hrsg. von
Andreas Hammer. Heidelberg 2010 (besonders:
Vorwort) sowie darin
Jing Xuan: Erzählen im Schwellenraum: Die Legende des
sündigen Hl. Grégoire, Seite 197-214.
13)
28.01.2013 – Die
Zusammenführung von Mutter und Sohn im ‚Gregorius’:
Das Ende des mythischen Heros
Ödipus und des heiligen Heros Gregorius – Vers 3831 - 4006
Themen:
a)
Das Motiv des Sehens und die narrative Fokalisierung in der 2. Begegnungsszene
mit Mutter und Sohn
Sekundärliteratur:
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
b)
Das Ende des mythischen Heros
Ödipus und des heiligen Helden Gregorius – eine christliche
Überwindung antiker Tragik?
Sekundärliteratur:
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
WEITERE MATERIALIEN WERDEN AUF DIESER HOMEPAGE ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT!
_________________________________________________________________________
VORLESUNG SS 2012
Vorlesung Sommersemester 2012 Prof. Dr. SIEGLINDE HARTMANN
Der
‘Gregorius’ des Hartmann von Aue und die Wiederkehr des Ödipusmythos
Beginn der
Lehrveranstaltungen: Montag 23. April 2012
Ort:
Philosophiegebäude Hörsaal 2
Mittelalter-Mythen zu erforschen gehört zu den
jüngsten Forschungsfeldern der Mediävistik. Neben dem Wiederaufleben von
germanischen und keltischen Mythen, stellt uns besonders die
hochmittelalterliche Wiederkehr von Mythen aus der griechischen und römischen
Antike vor zahlreiche ungelöste Rätsel. Auffällig, aber weitgehend ungeklärt,
bleibt unter anderem, dass die gelungensten Beispiele einer inneren Umformung
antiker Mythen und ihrer Zentralgestalten im Medium der neuen literarischen
Gattungen höfischer Erzählkunst entstanden sind.
Ohne nachweisliche Kenntnis des antiken
Ödipus-Mythos hat der höfische Epiker Hartmann von Aue gegen Ende des 12.
Jahrhunderts die mittelalterliche, altfranzösische Legende von einem
sagenhaften Papst Gregor aufgegriffen, um an seinem Schicksal darzulegen, welch
gnadenhafte Wendung eine inzestuöse Mutter-Sohn-Beziehung erfahren kann.
Gegenüber der antiken Form der Tragödie und dem damit eng verbundenen Glauben
an ein von Göttern verhängtes Schicksal entwickelt der mittelalterliche Autor
Erzählstrategien, welche es seinem Protagonisten erlauben, einen für die
Menschheit neuartigen Weg der ‘Katharsis’ zu finden.
In der Vorlesung soll daher Hartmanns
Verserzählung im Gegenlicht der antiken Modelle beleuchtet werden, um
herauszufinden, wie der mittelalterliche Erzähler eine innere Umgestaltung der
antiken Mythenmotive erreicht.
Gleichzeitig soll gezeigt, wie der deutsche
Epiker Hartmann seine altfranzösische Vorlage in einigen Handlungsmotiven so
umgestaltet, dass die inneren Wandlungen seines Protagonisten plastischer
profiliert erscheinen und am Ende in eine christliche Remythisierung der
antiken Ödipusfabel münden.
Aus dieser Perspektive wird die Vorlesung einen
Überblick über die wesentlichen Interpretationsprobleme bieten, wie sie die
aktuelle mediävistische Forschung zu Hartmanns ‘Gregorius’ beherrschen.
Textgrundlage: Hartmann von Aue. Gregorius. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch.
Nach dem Text von Friedrich Neumann neu herausgegeben, übersetzt und
kommentiert von Waltraud Fritsch-Rößler. Stuttgart 2011 [Reclams UB 18764].
Zur Einführung:
Christoph Cormeau: Hartmann von Aue, in: Die
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Band 3, Spalten 500-520;
Christoph Cormeau und Wilhelm Störmer: Hartmann
von Aue. Epoche – Werk – Wirkung. 3. Aufl. München 2007.
Francis
G. Gentry: A Companion to the Works of Hartmann von Aue. Rochester et. al. 2005.
Ulrich Müller, Werner Wunderlich (Hrsg.):
Mittelalter-Mythen. Band 1: Herrscher, Helden, Heilige. St. Gallen 1996,
Einleitung, S. IX-XIV.
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007.
SPRECHSTUNDE:
MONTAGS 14.00 bis 15.00 Uhr
Folgende Terminübersicht zeigt an, zu welchem Zeitpunkt und Frist die Anmeldung zu Prüfungen getätigt werden kann:
VORLESUNGSPLAN
1)
Montag 23. April 2012
Einführung: Hartmann von Aue und sein ‘Gregorius’
2) Montag 30. April 2012
Die mittelalterliche Legende und der antike Mythos:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
3)
Montag 07. Mai 2012
Inzestgeburt des
‘neuen’ Helden: die Eltern zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung – Vers
451-500
Materialien Literatur + Definitionen VL 3
4)
Montag 14. Mai 2012
Auffindung des
Kindes in antiken Ödipusmythen, in der Bibel und bei Hartmann – Vers 924-938 +
1008-1033
5)
Montag 21. Mai 2012
Gregorius’
Jugend und seine erste Missetat: Einbruch mythischer Motive? Vers 1285-1335 +
1359-1374
6)
Montag 04. Juni 2012
Gregorius’ 1.
Ausfahrt und Begegnung mit der Mutter: das mythische Motiv der Blindheit und
seine christliche Umdeutung – Vers 1894-1969
7)
Montag 11. Juni 2012
Gregorius zweite
Missetat: sein inzestuöses Eheleben und das Motiv der allmorgendlichen Buße –
Vers 2224-2294
8)
Montag 18. Juni 2012
Die Entdeckung
des Inzests und die biblischen Beispielfiguren sündiger Verzweiflung – Vers
2589-2663
9)
Montag 25. Juni 2012
Strafe für den
Inzest: Ödipus und sein Sohn Polyneikes, Gregorius’ Buße und der Fischer – Vers
3274-3370
10)
Montag 2. Juli 2012
Die 2. Auffindung des Gregorius und das neue ‘Heldenideal’ des “gottes trût” – Die
Metamorphose antiker Heroen in selbstbestimmte christliche Helden
MATERIALIEN ZUR VORLESUNG
STEHEN AUF MEINER
HOMEPAGE ZUM DOWNLOAD BEREIT:
http://www.sieglinde-hartmann.com
BUTTON: Academic Program
_________________________________________________________________________
Prof
Prof. Dr.
Sieglinde Hartmann
Hauptseminar
WS 2011/2012
Mit
Gastkonzert von Dr. Silvan Wagner
(Universität
Bayreuth) am 06.02.2012
Raum: 2.003
im Zentralen Hörsaal- und
Seminargebäude
Zeit: montags
16.00-18.30 Uhr, Beginn: 24.10.2011
DIE DEUTSCHE
LIEBESLYRIK VOM KÜRENBERGER BIS ZU OSWALD VON WOLKENSTEIN
Bis
heute bleibt erstaunlich, wie rasch sich die erste profane Liebesdichtung in
deutscher Sprache seit der Mitte des 12. Jahrhunderts unter dem Einfluss der
höfisch ritterlichen Dichtung nach französischem Vorbild zu einer
eigenständigen, bis heute unübertroffen variantenreichen Liedkunst entfaltet
hat. Besonders faszinierend wirkt, mit welch nachhaltiger Suggestivkraft die
deutschen Minnesänger die profane Liebe zum alles beherrschenden Thema
entwickelt haben, welches das Geschlechterverhältnis weit über ihre Zeit hinaus
prägen sollte.
Ziel
des Hauptseminars ist es, den poetischen Erfindungsreichtum und die
Originalität der einzelnen Dichterpersönlichkeiten anschaulich zu machen. Daher
sollen charakteristische Lieder aller Entwicklungsphasen vom frühen ‘donauländischen’ Minnesangs (von ca. 1150) bis zu Oswald
von Wolkenstein (ca. 1410-1430) in Einzelanalysen erarbeitet werden. Die
Liedauswahl soll gleichzeitig dazu dienen, die mittelalterliche deutsche
Liebeslyrik in ihrer gattungstypischen Entfaltung, metrischen Baukunst und
überlieferungsgeschichtlichen Eigenart zu erhellen.
Ein
Leistungsnachweis kann aufgrund eines Referats (+ schriftliche Fassung) oder
mittels einer Hausarbeit erworben werden.
S i t z u n g s p l a n
1)
24.10.2011 – Einführung: Entstehung des Minnesangs und Entwicklungsphasen der
Liebeslyrik bis zu Oswald von Wolkenstein, Überlieferung der Minnelyrik
(Budapester Fragment, Hss. A, B, C + Wolkenstein-Hss.), Sangbarkeit = höfische Liedkunst;
Erläuterung des Seminarplans, Verteilung der Referate / Hausarbeiten
2)
31.10.2011 – Der Kürenberger und der ‘Donauländische Minnesang’
Themen:
a) Das
‘Falkenlied’ des Kürenbergers in der Überlieferung
der Großen Heidelberger Liederhandschrift C und im Budapester Fragment;
b) Gender Aspekte bei der Liedlyrik des Kürenbergers:
Polarisierung von weiblichen und männlichen Rollen;
c) Die
Rezeption des ‘Falkenlieds’ im ‘Nibelungenlied’: Kriemhilds Falkentraum (1. Âventiure)
3)
07.11.2011 – Frühhöfischer Minnesang: Heinrich von Veldeke
(MF XII) und Kaiser Heinrich VI.
Themen:
a) Die Minne
als neue ‘Göttin’ der Liebe bei Heinrich von Veldeke
– Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation des Liedes MF XII;
b) Das Lob
Gottfrieds von Straßburg auf Heinrich von Veldeke und
die Einführung französischer Formkunst sowie der Konzeption der Hohen Minne in
den deutschen Minnesang;
c) Kaiser
Heinrich VI. als Minnesänger: ein Profil seiner Persönlichkeit als Kaiser und
als Minnesänger mit Interpretation des Liedes MF III.
4) 14.11.2011 –
Friedrich von Hausen: Hohe Minne, ‘Fernliebe’ und Kreuzzugslyrik
Themen:
a) Die
Konzeption der Hohen Minne bei Friedrich von Hausen: Übersetzung, metrisches
Schema und Interpretation des Liedes MF XIV;
b) Kaiser
Friedrich Barbarossas Kreuzzug (1187-1192), die Kreuzzugsteilnahme Friedrichs von
Hausen und seine Bearbeitung des französischen Kreuzzugsliedes ‘Ahi, Amours!’ im Lied MF VI.
5)
21.11.2011 – Albrecht von Johansdorf: Kreuzzugslyrik und
‘Herzensliebe’
Themen:
a) Albrecht
von Johansdorf und die ‘Herzensliebe’: Überlieferung
und inhaltliches Profil seiner Lieddichtungen mit Fokussierung auf Lied MF VIII
‘Wie sich minne hebt, daz weiz ich wol’;
b) Die
Kreuzzugsthematik bei Albrecht von Johansdorf und
Friedrich von Hausen: Parallelen und Unterschiede in ihrer Bearbeitung des
französischen Kreuzzugsliedes ‘Ahi, Amours!’.
6)
28.11.2011 – Hartmann
von Aue MF XV: ‘Unmutslied’
Themen:
a) Hartmann
von Aue und die Relevanz der Minnethematik in seinen höfischen Romanen ‘Erec’ und ‘Iwein’;
b) Hartmann
von Aue: der erste Kritiker der Hohen Minne? Eine Interpretation mit
Übersetzung und metrischem Schema des ‘Unmutsliedes’ (MF XV).
7) 05.12.2011 – Wolfram
von Eschenbach: Tagelieder
Themen:
a)
Wolfram von Eschenbach, sein episches Werk und die Relevanz der Minnethematik
in seinem höfischen Roman ‘Parzival’;
b) Das Tagelied
im deutschen Minnesang: Herkunft und Profil einer Liedgattung vom Minnesang bis
zu Oswald von Wolkenstein;
c)
Wolframs Tagelied ‘Sîne klâwen’
– Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
Literatur und Arbeitsbücher zur deutschen Literatur des Mittelalters
8)
12.12.2011 – Heinrich von Morungen: Tagelieder und ‘Traumliebe’
Themen:
a) Heinrich
von Morungen, Überlieferung und thematische Schwerpunkte seiner Lieddichtungen;
b) Heinrich von
Morungen und seine Poetik des Schauens: Übersetzung, metrisches Schema und
Interpretation des Lieds MF XIII;
c) Das
Tagelied ‘Owê’ (MF XXX) Heinrichs von Morungen und
seine Bildregie: Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
9)
19.12.2012 – Heinrich von Morungen: ‘Narzisslied’ – südfranzösisches Vorbild
und Antikenrezeption
Themen:
a) Die
Rezeption antiker (römischer und griechischer) Mythenstoffe in der höfischen
Literatur und im Minnesang: Heinrich von Veldekes Eneasroman und die Ovid-Rezeption im Minnesang;
b) Der antike Mythos von Narziss und seine
Wiederaufnahme im ‘Narzisslied’ bei Heinrich von Morungen und seinem anonymen
französischen Vorbild.
Titelblatt+Gliederung Hausarbeit
Gebrüder Grimm: Möringers Wallfahrt
10)
09.01.2012 – Reinmar: Minneklagen und Minneleid
Themen:
a)
Reinmar der Alte: Überlieferung und thematisches Spektrum seiner
Lieddichtungen;
b) Reinmar als
Meister der Minneklage: Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation des
Lieds MF XV.
11) 16.01.2012 – Walther
von der Vogelweide: Lieder der Hohen Minne und das ‘Lindenlied’
Themen:
a) Walther
von der Vogelweide und die neuen thematischen Schwerpunkte seines Minnesangs:
Lieder der ‘niederen Minne’ und der ‘hohen Minne’;
b) Walther
von der Vogelweide und die Interpretationen seines ‘Lindenlieds’: Übersetzung,
metrisches Schema und kritische Reflexion der Forschung.
12) 23.01.2012 – Oswald
von Wolkenstein: Pastourellen und Tagelieder
Themen:
a) Oswald von
Wolkenstein: Überlieferung, thematische Gliederung und Innovationen seiner
Liedkunst;
b) Wolkensteins
Variationen des Tagelieds und sein ‘Antitagelied’: Übersetzung, metrisches
Schema und Interpretation des Lieds ‘Ain tunckle farb’ (Kl 33);
c) Wolkensteins
Pastourellen: Gattungsprofil am Beispiel des Liedes
‘Ain jetterin’ (Kl 83).
13) 30.01.2012 – Oswald
von Wolkenstein: Liebeslieder
Themen:
a) Liebe und
Erotik in Wolkensteins Lieddichtungen: die unterschiedlichen Liedgattungen und
ihre divergierende Wertungen;
b) Wolkensteins
Lieder an Margarete von Schwangau: Zuordnung zu Liedgattungen und Profil der
formalen wie inhaltlichen Innovationen;
c) Das
Liebesduett ‘Simm Gredlin,
Gret’ (Kl 77): Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
14) 06.02.2012 Gastkonzert von Dr. Silvan Wagner (Universität Bayreuth)
Textgrundlage:
Minnesang:
Mittelhochdeutsche Liebeslieder. Mhd. / Nhd. Eine Auswahl hrsg. von Dorothea
Klein. Stuttgart 2010 (= Reclam UB 18781), EUR 16,00 (mit
Auswahlbibliographie zu den Liedtexten);
oder
Deutsche
Gedichte des Mittelalters. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählt,
übersetzt und erläutert von Ulrich Müller. In Zusammenarbeit mit Gerlinde
Weiss. 2. Auflage Stuttgart: 2009 ( = Reclam UB 8849); EUR 12,80 (mit Auswahlbibliographie zu den Liedtexten und Autoren).
Die Texte zu
Oswald von Wolkenstein stehen zum Download auf der Homepage der Oswald von
Wolkenstein-Gesellschaft: www.wolkenstein-gesellschaft.com/texte_oswald/php.
Sekundärliteratur:
Johannes Spicker: Oswald von Wolkenstein. Die Lieder.
Berlin 2007 (= Klassiker Lektüren 10); Ulrich Müller / Margarethe Springeth (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin 2011 (mit Gesamtbibliographie).
DIE
THEMEN EIGNEN SICH FÜR REFERATE UND/ODER HAUSARBEITEN.
__________________________________________________________________________
Sieglinde Hartmann - Deutsche Klassiker der Weltliteratur: Das
‚Nibelungenlied’
Prof. Dr.
Sieglinde Hartmann. WS 2010/2011
Hauptseminar
in Übungsraum 10, montags 16.00–19.00, Beginn: 25.10.2010
Mittelalterliche Heldenepik:
Das
"Nibelungenlied" auf Basis der Hs. C
S i t z u n g s p l a n
Gastvortrag
(24.01.2011) von Prof. Dr. Horst Brunner (Würzburg)
über die mhd. Sangversepik und ihre Melodien,
anschließend
Gastkonzert: Das
‘Nibelungenlied’ in Ausschnitten dargeboten von Dr. Eberhard Kummer (Bassbariton,
Schoßharfe), 17:15-19:00
1) 25.10.2010: Einführung in Lektüre und Transkription der Hs. C +
Erläuterung der Seminararbeit
Montag 1. November ist Feiertag: keine Sitzung!
2) 8.11.2010 a)
Stofftraditionen: Geschichte, Sagenkreise und altnordische Überlieferung; b) der Prolog im Mittelalter und in Hs. C – Thema für Referat
bzw. Hausarbeit; c) Interpretation der Strophen 1-11: epische Neuformung
des Nibelungenstoffs und Gliederung der Handschriften in Åventiuren
3) 15.11.2010 a) das ‘Falkenlied’ des Kürenbergers
(MF I, 6-7) und Kriemhilds Falkentraum in der 1. Åventiure:
Liebeskonzeption, Männlichkeitsideal, Strophenform – Thema für Referat bzw.
Hausarbeit; b) Gudruns Traum in der ‘Völsungensaga’
und Kriemhilds Traum im NL (Str. 12-18)
4) 22.11.2010 a) die Gestalt Siegfrieds in altnordischer Überlieferung, im
‘Hürnen Seyfried’ und im NL
– Thema für Referat bzw. Hausarbeit; b) Siegfrieds ‘minne’
und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 279-306) – Einfluss des Minnesangs
5) 29.11.2010 a) die Gestalt Brünhilds in
altnordischer Überlieferung und im NL – Thema für Referat bzw. Hausarbeit;
b) Gunthers Brautwerbung (Str. 391-477): Formen symbolischer Kommunikation,
neuartige Erzählregie und die Funktion des Doppelbetrugs im NL
6) 6.12.2010 Brünhild in Worms
und ihre 2. Brautnacht (Str. 664-691): Umfunktionierung
mythischer Heldenepikmotive
7) 13.12.2010 a) Der heldische Affekt des
‘Zorns’ in archaischer Heldenepik und der "nît" in
christlich-mittelalterlicher Sündenlehre – Thema für Referat bzw. Hausarbeit;
b) Streit der Königinnen (Str. 823-838 + 845-853): Worin bestehen "zorn" und "nît" der Königinnen im
NL, und warum führen diese Motive zur Peripetie der Haupthandlung?
8) 20.12.2010 a) Xanten und die Verehrung des Hl. Viktors im Mittelalter –
Thema für Referat bzw. Hausarbeit; b) Ermordung Siegfrieds (Str. 924-925
+ 978-1010) – Realismus und Symbolik der Schauplatzschilderung: Christliche Remythisierung eines Vorzeithelden?
9) 10.01.2011 a) Rache im Alten Testament und in mittelalterlicher
Rechtsgeschichte: Rekonstruktion mittelalterlicher Rechtsnormen– Thema für
Referat bzw. Hausarbeit; b) Kriemhilds Trauer, Etzels Brautwerbung und
Kriemhilds Rache im NL (Str. 1273-1287) – Melker Fragment Str. 1170,4-1172,2 +
1175,1-1176,4 in Hs. B beachten!
10) 17.01.2011 a) Hagen in altnordischer Überlieferung und im NL – Thema
für Referat bzw. Hausarbeit; b) Zug zu den Hunnen, Donauüberquerung
(Str. 1560-1579): Hagen und die Wandlungen seines Persönlichkeitsbildes in den Hss. B und C
11) 24.01.2011 Gastvortrag von Prof. Dr. em. Horst Brunner
über die mhd. Sangversepik und ihre Melodien: 16.15-17.00
Uhr; anschließend
Gastkonzert:
Das ‘Nibelungenlied’ in Ausschnitten dargeboten von Dr. Eberhard Kummer
(Bassbariton, Schoßharfe), 17:15-19:00
12) 31.01.2011 a) Kriemhild und die Wandlungen ihres Persönlichkeitsbildes in den Hss. B und C – Thema
für Referat bzw. Hausarbeit; b) Kriemhilds Rache und Tod, Lektüre,
Übersetzung und Interpretation der Str. 2423-2440 mit Bewertung der
unterschiedlichen "nôt"– und "liet"–Fassungen
(B und C)
13) 07.02.2011 a)
Mittelalterliche Rezeptionsgeschichte - Die "Nibelungenklage"
und ihre Bewertung von Geschehen und Handlungsträgern – Thema für Referat
bzw. Hausarbeit (Ausgabe: Mhd. Text mit Übers. und
Kommentar von E. Lienert. Paderborn 2000; b)
Lektüre, Übersetzung und Interpretation der Verse 3393-3484 der ‘Klage’)
ANMELDUNGEN
ZU REFERATEN BITTE PER EMAIL AN:
Sieglinde.Hartmann@germanistik.uni-wuerzburg.de
LITERATUR
BITTE AUCH
DIE MATERIALIEN ZUR VORLESUNG VOM SOMMERSEMESTER 2010 UNTEN AUF DIESER SEITE
BEACHTEN!
Textgrundlagen:
Das Nibelungenlied. Nach der Hs. C der Badischen Landesbibliothek
Karlsruhe. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Hrsg. und übersetzt von Ursula Schulze.
München: dtv 2008,
oder
Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch
/ Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor. Ins Nhd. übersetzt und kommentiert von Siegfried
Grosse. Stuttgart: Reclam 2002 u. ö. (mit KOMMENTAR, Literaturverzeichnis und
Nachwort!).
Musikalische
Neuaufführung des Epos:
Nibelungenlied. Complete Recording by Eberhard Kummer
on two MP3 CDs. The Chaucer Studio. Brigham Young University. USA 2007.
Altnordische Nibelungendichtungen:
Die Götter- und Heldenlieder der Älteren. Übersetzt.
kommentiert und hrsg. von Arnulf Krause. Stuttgart: Reclam 2004.
Nordische Nibelungen. Die Sagas von den Völsungen,
von Ragnar Lodbrok und Hrolf
Kraki. Aus dem Altnordischen übertragen von Paul
Hermann. Hrsg. von Ulf Diederichs. Köln 1985.
Die Geschichte Thidreks von Bern
(= Thidrekssaga). Übertragen von Fine Erichsen. Jena
1924. Nachdruck München 1996.
Internetausgabe
der Hs. Cmit Abbildungen sämtlicher Seiten, Transkriptionen +
Teilübersetzungen + Links): http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.htmlZum Vergleich: Das Nibelungenlied. Nach der St. Galler Handschrift (= Hs. B) hrsg. und erläutert
von Hermann Reichert. Berlin: W. de Gruyter Verlag 2005.
Sprachliche Hilfsmittel und Lexika
Matthias LEXER: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig 1872-1878. Nachdruck
Stuttgart 1979 (mit Belegstellen).
Matthias LEXER: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
Neueste Auflage. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.
Hermann
PAUL: Mittelhochdeutsche Grammatik. 24. Aufl. Neu bearb. von P. WIEHL und Siegfried GROSSE. Tübingen: M. Niemeyer Verlag 1998.
Sekundärliteratur:
Winder
McCONNELL (Hrsg.): A Companion
to the Nibelungenlied. Columbia 1998.
Die
Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hg. von Joachim Heinzle,
Klaus Klein und Ulrike Obhof. Wiesbaden 2003.
Jürgen BREUER (Hrsg.): Ze Lorse bi dem münster. Das Nibelungenlied (Handschrift C).
Literarische Innovation und politische Zeitgeschichte. München: Wilhelm Fink
Verlag 2006.
Otfrid EHRISMANN: Nibelungenlied. Epoche - Werk
- Wirkung. 2. Aufl. München 2002.
Otfrid EHRISMANN: Das Nibelungenlied. München
2005 (= C.H.BECK WISSEN 2372).
Christoph
FASBENDER (Hrsg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2005.
Volker GALLÉ
(Hrsg.) Siegfried. Schmied und Drachentöter. Worms 2005 (= Band 1 der
Nibelungenedition).
John GREENFIELD (Hrsg.): Das
Nibelungenlied. Actas de
Simpósio Internacional 2000. Porto 2001.
Edward
HAYMES: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München 1999 [= UTB
2070].
Joachim
HEINZLE: Das Nibelungenlied. Eine Einführung. Frankfurt a.M.
1994 [=Fischer TB 11843].
Joachim
HEINZLE: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005.
Werner
HOFFMANN: Das Nibelungenlied. 5. Aufl. Stuttgart 1982 [= Slg.
Metzler 7].
Victor
MILLET: Germanische Heldendichtung im Mittelalter. Eine Einführung. Berlin
2008.
Jan-Dirk
MÜLLER: Das Nibelungenlied. Berlin 2002 [= Klassiker-Lektüren 2] –Neueste,
überarbeitete Auflage!
Ursula
SCHULZE: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 [= Reclam Literaturstudium 17604].
Zur Überlieferung:
Klaus
Klein: Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften des Nibelungenliedes;
+ Lothar Voetz: Die Nibelungenlied-Handschriften
des 15. und 16. Jahrhunderts im Überblick; + Joachim Heinzle:
Die Handschriften des Nibelungenliedes und die Entwicklung des Textes;
alle 3 Beiträge in: Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hrsg. von Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ulrike Obhof.
Wiesbaden 2003.
_________________________________________________________________________________________
Sieglinde Hartmann –
Vorlesung Sommersemester 2010:
Die Wiederkehr der Mythen
I:
Die Nibelungen und das
‚Nibelungenlied’

Erste Seite der ältesten Handschrift C des
‚Nibelungenlieds’; Pergament, ca. 1230; Codex Donaueschingen 63; Badische Landesbibliothek
Karlsruhe
Vollständig digitalisiert aufzurufen unter dem link
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.html
(Mit Einführung und Handschriftenbeschreibung!
Edition dieser Fassung
von:
Ursula Schulze (Hg.), Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch /
Neuhochdeutsch. Hg. und übersetzt von U. S. (dtv 13693), München 2008 (nach
Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 63).
Inhalt und Zielsetzung der
Vorlesung
Am
31. Juli 2009 sind die drei ältesten Handschriften des Nibelungenlieds in das UNESCO Register des
Weltdokumentenerbes aufgenommen worden. Damit zählt das mittelhochdeutsche Epos zu den ersten mittelalterlichen
Dichtungen Europas, welche zum immateriellen Erbe der gesamten
Menschheit gehören. Worin liegt das
Geheimnis dieser außerordentlichen Faszinationskraft begründet? Wie
vergleichbare Heldenepen der Weltliteratur, so hat sich die Wirkung des Nibelungenlieds ebenfalls über
Sprachbarrieren und Epochengrenzen hinaus entfaltet. Dabei zeigt die
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Nibelungenlieds,
dass die Wertschätzung dieses Werks eng mit dem Wiederaufleben von Sagen und
Mythen aus heroischer Vorzeit zusammenhängt. Aus heutiger Sicht gilt das 12.
Jahrhundert als die erste nachantike Epoche, die durch eine Wiederkehr von
Mythen in Literatur und (höfischer) Kultur geprägt ist. In der Vorlesung sollen
daher epochenspezifische Fragen nach dem Wiederaufleben der Nibelungenmythen
erörtert werden: Worin unterscheidet sich die Stoffgestaltung im Nibelungenlied von den altnordischen
Nibelungendichtungen? Wie viel Mythisches bleibt in den Hauptgestalten des mhd.
Epos’ noch wirksam? Welche neue Sinngebung suggeriert die Neuordnung von
Handlung und Figurenkonstellation? Warum haben spätere, mittelalterliche wie
neuzeitliche Bearbeitungen wieder auf die älteren Heldenmuster zurückgegriffen?
Was lernen wir daraus für die weitgehend noch unerforschte periodische
Wiederkehr von Mythen?
Das
sind einige der Fragen, die in der Vorlesung erörtert werden sollen.
Gleichzeitig bietet die Vorlesung einen Überblick über die wesentlichen
Interpretationsprobleme, wie sie die aktuelle mediävistische Forschung zum Nibelungenlied beherrschen. Die
Vorlesung wendet sich an fortgeschrittene Studierende und setzt daher die
Kenntnis des Nibelungenlieds voraus.
Textgrundlagen:
Das Nibelungenlied.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut
de Boor. Ins Nhd. übersetzt und
kommentiert von Siegfried Grosse. Stuttgart: Reclam 2002 u. ö. (mit
Literaturverzeichnis und Nachwort!).
Ursula Schulze (Hg.), Das Nibelungenlied.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hg. und übersetzt von U. S. (dtv 13693),
München 2008 (nach Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 63).
Musikalische Neuaufführung des Epos: Nibelungenlied. Complete Recording by Eberhard
Kummer on two MP3 CDs. The Chaucer Studio. Brigham
Young University
Folgende
Sammelbände bieten die neueste Sekundärliteratur:
Ehrismann,
Otfrid: Nibelungenlied. Epoche - Werk - Wirkung. 2. Aufl. München 2002.
Fasbender,
Christoph (Hrsg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2005.
Gentry,
Francis G., McConnell, Winder, Müller, Ulrich and Wunderlich, Werner (Hrsg.): The
Nibelungen Tradition. An Encyclopedia. New York
John Greenfield (Hrsg.): Das Nibelungenlied. Actas
de Simpósio Internacional 2000. Porto 2001.
Haymes, Edward: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München 1999 [= UTB 2070].
Heinzle,
Joachim, Klein, Klaus and Obhof, Ulrike (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage – Epos –
Mythos. Wiesbaden 2003.
Heinzle,
Joachim: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005.
Jefferis, Sibylle (Hrsg.): The Nibelungenlied: Genesis, Interpretation, Reception (Kalamazoo
Papers 1997-2005). Göppingen: Kümmerle 2006.
McConnell, Winder (Hrsg.): A Companion to the Nibelungenlied. Columbia 1998.
Müller,
Jan-Dirk: Das Nibelungenlied. Berlin 2002 [= Klassiker-Lektüren 2] – neueste
überarb. Auflage!
Schulze, Ursula: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 (= Reclam
Literaturstudium 17604).
VORANKÜNDIGUNG FÜR DAS
WINTERSEMESTER:
Sieglinde Hartmann Hauptseminar WS 2010/2011
Mittelalterliche
Heldenepik: Das Nibelungenlied auf Basis der Hs. C
Vorlesungsplan - Mo
15.00-16.30, Hörsaal 2
1) 26. April 2010 –
Einführung: Die Wiederkehr antiker Mythen im 12. Jahrhundert, ihre Quellen,
Stoffkreise und das ‚Nibelungenlied’
2) 3. Mai 2010 – Das
‚Nibelungenlied’ im Kontext archaischer Heldendichtungen, seine Überlieferung
im deutschen Sprachraum und die Verbreitung des Nibelungenstoffs in
altnordischer Literatur
3) 10. Mai 2010 – Neues Heldenideal und neue Strophenform:
Kriemhilds Traum (1. Âventiure nach Hs. C) und das ‚Falkenlied’ des Kürenbergers (MF
I, 6-7)
4) 17. Mai 2010 –
Siegfrieds „minne” und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 280-307- Hs. C) - Einfluss des Minnesangs und
höfische Überformung des Stoffes
5) 31. Mai 2010 – Die
Brautwerbung um Brünhild auf Island (7. Âventiure) -- neuartige
Personencharakterisierung und Kunst dramatischer Handlungsführung
6) 7. Juni 2010 – Brünhilds
2. Brautnacht in Worms: Umfunktionierung mythischer Heldenepikmotive +
symbolische Kommunikation im ‚Nibelungenlied’
7) 14. Juni 2010 – Streit der Königinnen (Str.
834-850) - Peripetie der Haupthandlung?
8) 21. Juni 2010 – Ermordung Siegfrieds (Str. 978-998) –
Christliche Remythisierung der Gestalt Siegfrieds?
9) 28. Juni 2010 – Neue methodische Paradigmen und ihre Funktion
für die Deutung des 2. Teils des ‚Nibelungenlieds’
10) 5. Juli 2010 – Der
Untergang der Nibelungen: die Kontrahenten Hagen und Kriemhild und ihre
Remythisierung im ‚Nibelungenlied’ und bei Richard Wagner
Tischvorlage zur 10. Sitzung: Hagen im Nibelungenlied im Link
Tischvorlage zur 10. Sitzung: Kriemhild im Nibelungenlied im Link
MATERIALIEN ZUR VORLESUNG
Zu 1) 26. April 2010 –
Einführung: Die Wiederkehr antiker Mythen im 12. Jahrhundert, ihre Quellen,
Stoffkreise und das ‚Nibelungenlied’
Die
bedeutendsten Heldenepen der Weltliteratur, ihre mythischen Stoffe, ihre
Verschriftlichung und ihre periodische Wiederkehr
1) Gilgamesh-Epos
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
um 2500 v. Chr.; Titelheros: König Gilgamesh (Lebenszeit: um 2600 oder 2500 v. Chr.) = Begründer der
Stadt Uruq, Hauptstadt des altsumerischen Reiches.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos von
Gilgamesh: circa 1200 v. Christus
in einem Großepos in 12
sogenannten ‚Tafeln’ von rund 3000 Versen; Autor unbekannt = rund 1200
Jahre später.
2) Homers ‚Ilias’ und
‚Odyssee’ (Fall von Troja)
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
13. oder 12. Jahrhundert v. Chr.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos der
‚Ilias’ (= Fall von Troja = Ilion): circa 800 v. Christus in einem Großepos von 24 Büchern mit etwa
15000 Versen (= Hexametern); Autor: Homer, mehr als Name nicht bekannt =
rund 500-600 Jahre später.
c) Wiederkehr der trojanischen Mythen im
12. Jahrhundert (in afz. und mhd. Versionen) sowie nochmals 600-800 Jahre später
in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
3) Die ‚Aeneis’ des Römers Vergil (Gründung Roms)
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
um 800-700 v. Chr.: Gründung Roms: 753
v. Chr. = ab urbe condita der römischen Zeitrechnung.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos der ‚Aeneis’: 29-19 v. Chr. in 12 Gesängen von
9896 Hexametern (unvollendet) = rund 700 Jahre später.
c) Wiederkehr der Mythen von der
Gründung Romas im 12. Jahrhundert (in afz. und mhd. Versionen) sowie nochmals
600-800 Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
4) Das ‚Nibelungenlied’ und die
Dietrichepik des Hochmittelalters
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
Völkerwanderungszeit ca. 400-600 n. Chr.:
Untergang der Burgunden: 437 n.
Chr.; Untergang des Hunnenreichs und Tod Attilas: 453 n. Chr.; Theoderich der
Große (ca. 451-526 = Dietrich von Bern)): Blüte und Ende des Ostgotenreichs in
Italien.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos des
’Nibelungenlieds’: um 1200 n. Chr. in
38 bzw, 39 Âventiuren von rund 10000 Langversen = rund 600-700 Jahre später.
c) Wiederkehr der Nibelungen-Mythen
600-700 Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
5) Die mittelalterliche Artusepik
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
Völkerwanderungszeit ca. 400-600 n. Chr.:
Zusammenbruch der Römerherrschaft in Britannien; Artus = legendärer
Stammesführer, der das Reich Britannien im 5. oder 6. Jahrhundert
wiederhergestellt habe.
b) Verschriftlichung in höfischen
Romanen mit König Artus und seinen Rittern von der Tafelrunde in afrz. und mhd.
Versionen des 12. und 13. Jahrhunderts =
rund 500-600 Jahre später.
c) Wiederkehr der Artusmythen 600-700
Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
Zu 2) 3. Mai 2010 – Das
‚Nibelungenlied’ im Kontext archaischer Heldendichtungen, seine Überlieferung
im deutschen Sprachraum und die Verbreitung des Nibelungenstoffs in
altnordischer Literatur
The Nordic Nibelungen Tradition and its Main Sources
1)
Poetic Edda , Iceland
2) The Prose Edda of Snorri
Sturluson (1179-1241); Anthony Faulkes (Ed.): Edda by Snorri Sturluson: Prologue and
Gylfaginning (Oxford 1982) and Edda by Snorri Sturluson: Skáldskaparmál,
2 vols. (London London
3)
The Völsungasaga, Norway ca. 1250; R. G. Finch (ed., transl.) The Saga of the Volsungs. London 1965;
German translation: Nordische Nibelungen.
Die Sagas von den
Völsungen, von Ragnar Lodbrok und Hrolf Kraki. Aus dem Altnordischen übertragen
von Paul Hermann. Hrsg. von Ulf Diederichs. Köln 1985.
4) Thidrekssaga, Norway, ca. 1250; Henrik Bertelsen (ed.): Thidreks Saga af Bern. 2 vols.
Copenhagen 1905-1911; German translation: Die
Geschichte Thidreks von Bern. Übertragen von Fine Erichsen. Jena 1924.
Nachdruck München 1996.
Inhaltsunterschiede zwischen deutschem und
altnordischen Nibelungenstoff
Hauptgestalten: 3 königliche Familien und Brünhild
In der skandinavischen Nibelungentradition werden die
Burgunden stets ‚Niflungen’ genannt = ‚Nibelungen’
Das mittelhochdeutsche ‚Nibelungenlied’
1) Der Burgundenhof in Worms am Oberrhein
Königinmutter: Uote, Vater:
Dancrat
3
Söhne: Gunther, Gernot, Giselher + Schwester Kriemhild
Höchster Vassal: Hagen
(= Högni), Siegfrieds Mörder
2) Der Königshof der ‚Niederlande’ in Xanten am
Niederrhein
Königinmutter: Sieglinde,
Vater: Sigismund
1 Sohn: Siegfried = Kronprinz von Niederland, Herrscher über die
Nibelungen, wirbt um Kriemhild und heiratet sie
3) Der Hunnenhof in Etzelburg a.d. Donau
König: Etzel (= Attila),
heiratet Kriemhild in 2. Ehe, um
die êre, das Ansehen seiner Macht zu erhöhen.
4) Brünhild = Unbezwingbare jungfräuliche Königin von Îslant mit Isenstein als Hauptburg;
Brautwerber müssen 3
Freierproben bestehen, was nur Sioegfried gelingt (an Gunthers Stelle), daher
heiratet Brünhild Gunther
Die altnordische Tradition
1) Der Hof der Niflungen
Königinmutter: Grimhild,
Vater: Gjuki
3 Söhne: Högni, Gunnar,
Guthorm (= Sigurds Mörder) + Schwester
Gudrun
2) Der Hof König
Sigismunds
Königin: 2 Namen genannt:
Sisibe, Hjordis; 1 Name nicht erwähnt
1 Sohn: Jung Sigurd, der
Fafnir (= Drachen) Töter, erringt Nibelungenschatz,
liebt Brynhild, aber nach einem Vergessenstrank heiratet er Gudrun
3) Der Hunnenhof (unterschiedliche Orte in Nordwestdeutschland, u.a.
Soest)
König: Atli (= Attila)
heiratet in 2. Ehe Gudrun, Sigurds Witwe, um in den Besitz des Niflungenhorts zu gelangen
4) Brynhild = Walküre, Tochter von Odin (höchster Gott in anord. Mythologie), in einigen
Dichtungen ist sie Atlis Schwester, meist mit Sigurd verlobt, aber sie
heiratet Gunnar
Zu 3) 10. Mai 2010 – Neues Heldenideal und neue Strophenform:
Kriemhilds Traum (1.
Âventiure nach Hs. C) und das ‚Falkenlied’ des Kürenbergers (MF
I, 6-7)
Zu 4) 17. Mai 2010 –
Siegfrieds „minne” und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 280-307- Hs. C)
- Einfluss des Minnesangs und
höfische Überformung des Stoffes
Zu 5) 31. Mai 2010 – Die Brautwerbung
um Brünhild auf Island (7. Âventiure) -- neuartige Personencharakterisierung
und Kunst dramatischer Handlungsführung
Zu 6) 7. Juni 2010 –
Brünhilds 2. Brautnacht in Worms: Umfunktionierung mythischer Heldenepikmotive
+ symbolische Kommunikation im ‚Nibelungenlied’
Zu 7) 14. Juni 2010 – Streit der Königinnen (Str.
834-850) - Peripetie der Haupthandlung?
Zu 8) 21. Juni 2010 – Ermordung Siegfrieds (Str. 978-998) – Christliche Remythisierung der Gestalt Siegfrieds?
Sieglinde Hartmann SS 2010 VL :
Die Nibelungen und das “Nibelungenlied”
Handlungsstrukturen, Motive und Schauplätze im
Vergleich:
Siegfried/Sigurd (anord.), Brünhild + Kriemhild
(anord: Gudrun)
Ältere Edda
Snorris Prosa-Edda
Völsungensaga
Thidrekssaga
Nibelungenlied
Abstammung + Vorgeschichte:
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin)
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin)
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin)
Königsgeschlecht von Tarlungaland = in Schwaben?
Königsgeschlecht von
“Niederland” am Rhein
Eltern:
Vater: Siegmund, Mutter: namenlos
Vater: Siegmund, Mutter:
Hjördis
Vater: Siegmund, Mutter:
Hjördis
Vater: Siegmund, Mutter: Prinzessin
Sisibe von Spani-
en
Vater: Siegmund, Mutter: Sieglinde,
Residenz: Xanten
Geburt, Jugend + Erziehung
Als Ziehsohn beim Schmied
Regin, Ort: am Rhein
Als Ziehsohn des Schmieds
Regin am Hof König Hjalpreks (= Hjördis 2. Gatte) in Dänemark
Am Hof König Hjalpreks (=
Hjördis 2. Gatte) in Däne-
Mark mit Regin als Erzieher
Die unschuldig verstoßene
Sisibe gebiert Sigurd im Wald, Aussetzung des Kindes im Glasgefäß; Errettung
durch Hindin, Auffinden durch Schmied Mime, Erziehung zum Schmied
Königlich ritterliche
Erziehung am Xantener Hof
1. Heldentat = Drachentöter
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Gnitaheide
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Gnitaheide
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Heide
Tötung des Drachens (=
Mimes Bruder) im Wald
Nur indirekt in Hagens
Bericht er-
wähnt
2. Wunder = Drachenblut
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung
Berührung mit Brühe aus Drachenfleisch
= Verständnis der Vogelsprache +
Vogelweissagung + Erlangung einer Hornhaut durch Bestreichen mit Drachenblut
Nur indirekt in Hagens
Bericht er-
wähnt :
Erlangung einer Hornhaut
durch Bad im Drachen-
Blut; verwundbare Stelle
durch Lindenblatt zwischen Schulterblättern
3. Heldentat = Erbeutung des
Nibelungen-
horts
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts
NICHT DARGESTELLT
Nur indirekt in Hagens
Bericht er-
wähnt :
Erbeutung des
Nibelungenhorts durch Töten der Brüder Niflung + Schilbung
4. Heldentat = Erlösung Brünhilds
(= Walküre, von Odin zur Strafe für Ungehor-
sam in Schlaf auf Berg/Burg
gebannt)
S. überwindet Schildwall auf
Berg Hindarfjall u. zerschneidet die Brünne der Sigrdrifa (= Name für
Brünhild) + Variante im “Jüngeren Sigurdlied”: Brünhild = Schildmaid +
Schwester des Hunnenkönigs Atli
S. reitet zum Haus auf Berg
u. erweckt die Walküre Brünhild durch Zerschneiden der Brünne
S. reitet zum Berg
Hindarfjall, südwärts im Frankenland, u. erweckt die Schildjungfrau +
Königstochter Brünhild durch Zerschneiden der Brünne, sie schwören sich ewige
Liebe + nach weiteren Abenteuern
2. Wiedersehen mit Br. + 2.
Liebesschwur + Weissagung der Ehe mit Gudrun
S. reitet zu Brünhilds Burg,
um Hengst Grane aus ihrem Gestüt zu holen
(Später heißt es, Sigurd +
Brünhild hätten sich bereits bei ihrem 1. Treffen eidlich verbunden)
Nicht dargestellt, aber
frühere Begegnung mit Brünhild stillschweigend vorausgesetzt
5. Station: Hof der
Burgunden, Namen der Königsfamilie
Burgunden = Niflungen,
Vater: Gjuki,Mutter: Grimhild; Söhne:
Gunnar, Högni, Gotthorm, Schwester: Gudrun
Niflungen, Vater:
Gjuki, Mutter: Grimhild; Kinder:
Gunnar, Högni, Gudrun, Gudny; Gotthorm = Gjukis Stiefsohn
Niflungenhof, südlich am
Rhein, Vater: Gjuki,Mutter: Grimhild;
Kinder: Gunnar, Högni, Gutthorm, Gudrun
Mit König Thidrek ins
Niflungenland, König: Gunnar, Brüder:
Högni + Gernoz, Schwester: Grimhild; Resi-
denzstadt: Werniza
Burgunden in Worms am Rhein,
Vater: Dankrat, Mutter: Uta; Kinder:
Gun-
ther, Gernot, Gisel-
her, Kriemhild
6. Wunder: Vergessens-
trank
Königinmutter Grimhild
löscht Erinnerung an Brünhild aus
7. Liebe zur burgundischen Prinzessin
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau aufgrund des Vergessenstranks
Sigurd erhält Grimhild zur
Frau
Fernliebe zu Kriemhild von
Anbeginn aufgrund ihres höf. Wesens, ihrer Schönheit + Tugend
8. Verhältnis zu König
Gunther
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
“triuwe” - kein Eid
9. Verhältnis zu Hagen
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur
10. Brautwerbung um
Brünhild für Gunther, Erfolg durch Siegfrieds Täu-
schungsma-
növer
Sigurd überwindet
Schildwall, erlöst Brünhild, vollzieht aber nicht das Beilager
Täuschungsmanöver:
Gestaltentausch; Sigurd reitet für Gunnar durch Waberlohe, vollzieht nicht
das Beilager, aber tauscht mit Brynhild Ringe (Andwaris Ring aus
Nibelungenhort = Morgengabe für B.)
Täuschungsmanöver:
Gestaltentausch; Sigurd reitet für Gunnar durch Waberlohe, vollzieht nicht
das Beilager, aber tauscht mit Brynhild Ringe (Sigurd nimmt B. den Ring
Andwaris + gibt ihr einen anderen Ring
aus Nibelungenhort)
Brautwerbung um B. (=
Königin der Stadt Seegard in Schwaben) für Günther durch Gespräch und
Beratung mit den Königen Thidrek + Gunnar; Brünhild willigt schließlich ein
Brautwerbung um Königin
Brünhild für Gunther, Siegfried täuscht B. mit Standeslüge + bezwingt sie im
Wettkampf mithilfe des Tarnmantels
11. Ehe von Kriemhild und
Siegfried
glücklich
2 Kinder: Sigmund +
Svanhild
1 Kind: Svanhild
Glücklich: 1 Sohn: Gunther
12. Ehevollzug von Brünhild
und Gunther nach Siegfrieds 2. Täuschungs-
manöver
Brünhilds Ehe = “Unheil”,
von Nornen vorherbestimmt
Nach Brünhilds + Gunnars
Hochzeit erinnert sich Sigurd an seine Liebesschwüre
Sigurd bezwingt Brünhild in
der 2. Brautnacht mithilfe eines Kleidertauschs, entjungfert sie + Ringtausch
Siegfried bezwingt Brünhild
in der 2. Brautnacht mithilfe der Tarnkappe, entwendet ihr Ring + Gürtel, entjung-
fert sie jedoch nicht
13. Brünhilds “nít”
Brünhild neidet Gudrun den
Gatten, weil sie nur ihn liebt
NICHT DARGESTELLT
NICHT DARGESTELLT
NICHT DARGESTELLT
Brünhild unglücklich aus Neid
auf Kriemhild + aus Verdacht, betrogen worden zu sein; daher hinterlistige
Einla-
dung nach Worms
14. Zerwürfnis der
Königinnen
Beim Haarewaschen im Fluss
provoziert Brynhild Gudrun: Gunnar sei der kühnere Held, weil er die
Waberlohe durchritten habe; Gudruns Antwort: Vorzeigen des Rings Andvaranaut
als Beweis für Sigurd als B.”s Bezwinger
Beim Baden im Fluss
provoziert Brynhild Gudrun: Gunnar sei der kühnere Held, weil er die
Waberlohe durchritten; Gudruns Antwort: Vorzeigen des Rings als Beweis für
Sigurd als B.”s Bezwinger; B. entdeckt den Betrug an ihr + an Sigurd
Brünhild provoziert Grimhild
zum Rangstreit in der Königshalle, Grimhilds Antwort: Vorzeigen des Rings als
Beweis dafür, dass Sigurd B.”s
bezwungen + entjungfert hat
Brünhild provoziert Kriemhild
zum Rangstreit auf der Treppe zum Wormser Münster; Kriemhilds Ant-
wort: Siegfried sei ihr
Bezwinger gewesen, Vorzei-
gen von Ring + Gürtel als
Beweise dafür, dass Siegfried B.
entjungfert hat
15.Brünhild = Anstifterin
zum Mord an Siegfried
Da sie Sigurd nicht haben
kann, muss er sterben
Betrug an Brynhild = Motiv
für S.”s Ermordung
Betrug an B. = Motiv für
S.”s Ermordung
Rache für öffentliche
Entehrung = Motiv für S.”s Ermordung
Rache für öffent-
liche Entehrung = Motiv für
S.”s Ermordung
16. Ermordung des unbewaff-
neten Sieg-
frieds
a) Mörder
Ältere Edda
Anstifterin : Brünhild, ausführender
Mörder: Gotthorm; Eidbrüchig:
Gunnar; Högni widerrät, aber
widersetzt sich nicht; daher alle 3 = Mörder
Prosa-Edda
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Gotthorm;
Eidbrüchig: Gunnar + Högni = 3 Mörder
Völsungensaga
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Gotthorm;
Eidbrüchig: Gunnar; Högni widerrät,
aber widersetzt sich nicht; daher alle 3 = Mörder
Thidrekssaga
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Högni mit Gunnars
Einverständnis
Nibelungenlied
Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Hagen mit
Gunthers Billigung
17. Siegfrieds Ermordung
b) Schauplatz
“südlich am Rhein” im Wald
oder im Bett, Ed. A. Krause, S.354 + 357
Im Schlaf im Bett
Im Schlaf im Bett
Im Wald auf der Jagd bei
einer Rast ersticht Högni den trinkenden Sigurd von hinten zwischen den
Schulterblättern mit Sigurds Speer
Auf der Jagd auf einer
bewaldeten Rheininsel vor dem Odenwald; bei der Rast ersticht Hagen den trinkenden Siegfried von hinten
zwischen den Schulterblät-
tern mit dessen Speer
18. Brünhilds Ende
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche + “Helfahrt”
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche
Nicht dargestellt
19. Kriemhilds Rache + Ende
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Ende: Tod aller aus Rache für den Mord an ihren Brüdern
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Ende: Tod aller aus Rache für den Mord an ihren Brüdern
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Atli lädt Högni + Gunnar ein, aus Gier nach dem Hort + um
seine Schwester (= Brynhild) zu
rächen; Ende: Tod aller Hunnen, Gudrun überlebt + verheiratet sich zum 3. Mal
(mit König Jonakr)
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), sie lädt Högni + Gunnar ein, um Sigurds Ermordung zu rächen; Ende: Tod aller Hunnen +
Niflungen, Gudrun wird von Thidrek erschlagen
Kriemhild vermählt sich zum
2. Mal (mit Etzel), sie lädt ihre 3 Brüder + Hagen ein, um Siegfrieds Ermor-
dung zu rächen; Ende: Tod vieler Hunnen + aller Nibelungen,
Kriemhild wird von Hildebrand in Stücke gehauen
Ältere Edda
Prosa-Edda
Völsungensaga
Thidrekssaga
Nibelungenlied
Zu 9) 28. Juni 2010 – Neue methodische Paradigmen und ihre Funktion für die Deutung des 2. Teils des ‚Nibelungenlieds’
Zu 10) 5. Juli 2010 – Der
Untergang der Nibelungen: die Kontrahenten Hagen und Kriemhild und ihre
Remythisierung im ‚Nibelungenlied’ und bei Richard Wagner
Prof. Dr. Sieglinde Hartmann –
Hauptseminar SS 2013
Oswald von
Wolkenstein (ca. 1376/77-2.8.1445)
Zeit: Montags
16.00-18.30, Ort: Phil-Geb. ÜR 24
S E M I N A R P L A
N
1) 21. Oktober - Einführung und
Themenvergabe
2) 28. Oktober – Autobiographische Lyrik:
Begriffsbestimmung, Lektüre, Übersetzung + Interpretation von Kl 18 (Sprecherrollen, Signalwörter, Dechiffrierung
der Bildsprache, Visualisierungsstrategien, Komik und Ironie)
3) 04. November – Das neue Genre der
(autobiographischen) Reiselieder (Kl 19, Kl 41 + 44) - mit Gastvortrag von Prof. Dr. Danielle Buschinger
(Amiens): Wolkensteins politische und moral-didaktischen Lieder und ihre
Bezüge zur Sangspruchdichtung
4) 11. November – Wolkensteins politische Lyrik (Kl 85, Kl
27 + 113)
5) 28. November – Wolkensteins Liebeslyrik (1): Tagelieder (Kl 101, 48, 33)
6) 25. November – Wolkensteins Liebeslyrik
(2): Dialoglieder (Kl 43 + 79, Kl 71 + 77)
7) 02. Dezember – Wolkensteins Liebeslyrik
(3): Pastourellen und Schäferdichtung (Kl 78 +
83, Kl 92 und das ‚Kuhhorn’ des Mönchs von Salzburg)
8) 09. Dezember – Wolkensteins neuartige
Naturbilder: die autobiographischen ‚Hauensteinlieder’ (Kl 104, Kl
116) und die Frühlingslieder Kl 42 + 50
9) 16. Dezember – Weltenlust (Trinklieder Kl
54, 70, 84) und Weltverneinung (Weltabsagelieder Kl 9 + 11)
10) 13. Januar – Wolkensteins
autobiographische Lieder über seine Gefangenschaften (Kl 55, 59 + 26; Kl 1
+ 7)
11) 20. Januar – Todesfurcht in Wolkensteins
autobiographischen Liedern Kl 23 + 6 – mit Gastvortrag P. Winfried Schwab OSB, Subprior des Benediktinerstifts Admont und Präsident der österreichischen Totentanzvereinigung zum Thema: ‘Oswald von Wolkenstein und das Phänomen der Totentänze’.
12) 27. Januar – Wolkensteins geistliche Lieder:
Marienlieder
13) 01. Februar - Wolkensteins Religiosität:
Beichtlied KL 39 und Höllenlied Kl 32 - ENTFÄLLT!
Vortragszeit des mündlichen
Referats: 20-30 Minuten + 10 Minuten Diskussion; Umfang der schriftlichen
Ausarbeitung: max. 15 DinA4-Seiten + Bibliographie. – Die Interpretation
eines Liedes umfasst: Übersetzung, metrisches Schema, Einordnung in
Gattungstradition oder biographischen Kontext, Analyse von Inhalt und Form
unter dem vorgegebenen Aspekt und in Auseinandersetzung mit der
einschlägigen Sekundärliteratur; wenn möglich mit
Vorführung einer Einspielung oder eigenem Gesangsvortrag.
Achtung: die
Kenntnis der Biographie Oswalds von Wolkenstein ist Voraussetzung zur Teilnahme
am Seminar!
Textgrundlage:
Die Lieder Oswalds von Wolkenstein. Unter Mitwirkung von
Walter Weiss und Notburga Wolf hrsg. von Karl Kurt Klein. Musikanhang von Walter Salmen. Tübingen 1962, 3.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage von Hans Moser, Norbert Richard Wolf
und Notburga Wolf. Tübingen
1987 (= Altdeutsche Textbibliothek 55) =
wissenschaftliche Standardausgabe, zitiert: Kl + Liednummer.
Ohne Variantenapparat stehen alle
Texte der Klein’schen Ausgabe auf der Homepage der Oswald von
Wolkenstein-Gesellschaft kostenlos abrufbereit: http://www.wolkenstein-gesellschaft.com
Zur
Anschaffung empfohlene Teilausgabe:
Oswald von
Wolkenstein. Lieder. Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählte
Texte herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Burghart Wachinger. Melodien und Tonsätze
von Horst Brunner. Stuttgart:
Reclam Verlag 2007 (= UB 18490).
FOLGENDE
TITEL bzw. BIBLIOGRAPHISCHEN HILFSMITTEL GELTEN FÜR ALLE SITZUNGEN:
Josef SCHATZ: Sprache und Wortschatz der
Gedichte Oswalds von Wolkenstein. Wien und Leipzig 1930 (= Akademie der
Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 69,2).
Verskonkordanz zu den
Liedern Oswalds von Wolkenstein.
Hrsg. von George F. JONES, Hans-Dieter MÜCK und Ulrich MÜLLER. 2 Bde.
Göppingen 1973 (= G.A.G. 40/41).
Klaus J. SCHÖNMETZLER:
Oswald von Wolkenstein. Die Lieder mhd.-deutsch.
München 1979 [mit Rekonstruktion
aller Melodien!].
Burghart WACHINGER: Oswald von
Wolkenstein. Artikel in: Verfasserlexikon. 2. Aufl. Bd. 7. 1989. Sp. 134-169.
Werner MAROLD: Kommentar zu den
Liedern Oswalds von Wolkenstein. Hrsg. von Alan ROBERTSHAW. Innsbruck 1995 [Wichtige Erläuterungen zur Metrik!].
Anton SCHWOB: Oswald von
Wolkenstein. Eine Biographie. Bozen 1977.
Anton SCHWOB u.a. (Hrsg.): Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein,
Edition und Kommentar, 4 Bände. Wien, Köln 1999 / 2000 / 2004 / 2011
/ 2013.
Alan
ROBERTSHAW: Zur Datierung der Lieder Oswalds von Wolkenstein. In:
Rollwagenbüchlein. Fs. für W. Röll.
Hrsg. von Jürgen Jaehrling u.a.
Tübingen 2002, S. 107-135.
Ulrich
MÜLLER: "Dichtung" und "Wahrheit" in den Liedern
Oswalds von Wolkenstein: Die autobiographischen Lieder von den Reisen.
Göppingen 1968.
Sieglinde
HARTMANN: Oswald von Wolkenstein heute: Traditionen und Innovationen in seiner
Lyrik. In: JOWG Bd. 15 (2005), S. 349-372.
Johannes
SPICKER: Oswald von Wolkenstein. Die Lieder. Berlin 2007 (= Klassiker
Lektüren 10).
Sieglinde HARTMANN: Oswald von
Wolkenstein. Artikel in: Kindlers Literatur Lexikon. 3., völlig neu
bearbeitetet Auflage. Hrsg. von Heinz Ludwig ARNOLD. Stuttgart / Weimar 2009,
Band 12, S. 418-420.
Burghart
WACHINGER: Textgattungen und Musikgattungen beim Mönch von Salzburg und
bei Oswald von Wolkenstein. In: Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Berlin 2010, S.
385 – 406.
Oswald von Wolkenstein. Das
poetische Werk. Übers. von Wernfried HOFMEISTER.
Berlin u.a. 2011 [Sekundärliteratur
zu einzelnen Liedern, vor jeder Interpretation zu konsultieren!].
Ulrich MÜLLER / Margarete
SPRINGETH (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin u.a. 2011 [Forschungsbilanz mit vollständiger Bibliographie!].
Oswald von Wolkenstein im
Kontext der Liedkunst seiner Zeit. Hrsg. von Ingrid BENNEWITZ und Horst
BRUNNER: Wiesbaden 2013 (= JOWG Bd. 19).
Prof. Dr. Sieglinde Hartmann:
Oswald von Wolkenstein und die deutsche Lyrik des Spätmittelalters
Sommersemester 2013
Wann?
Montags 16.00-18.00 Uhr Wo? Hörsaal 2
VORLESUNGSPLAN
1) 22. April 2013 – Einführung
2) 29.
April 2013 – Traditionen und Innovationen in den Liedern Oswalds von
Wolkenstein
3) 06.
Mai 2013 – Die Reisen des Ritters Oswald von Wolkenstein und seine
autobiographischen ‘Reiselieder’ Kl 18, 19 und 44
4) 13. Mai 2013 – Wolkensteins politische
Lyrik: Der Kampf um Greifenstein in Tirol (Kl 85) und Wolkensteins Beteiligung an den
Reichskreuzzügen gegen die Hussiten (Kl 27 + Kl 134)
5) 03. Juni 2013 – Wolkensteins Lebenswelt und seine neuartigen Naturbilder: Die Pastourelle Kl 83, die ‘Hauensteinlieder’ Kl 116 und Kl 104 sowie das Vogelstimmenkonzert Kl 505)
6) 10. Juni 2013 – Minnesangtradition und Innovation in Wolkensteins Liebesliedern: die Tageliedvariationen Kl 101, Kl 53, das Neujahrslied Kl 61 Gelück und hail und das Liebesduett Kl 77 “Simm Gredlin, Gret”
7) 17. Juni 2013 – Weltenlust und Weltverneinung: Carmina Burana (In taberna quando sumus) vs. Oswalds Trinklied Her wiert, uns dürstet also sere (Kl 70), Walther von der Vogelweide Fro Werlt vs. Oswalds O welt, o welt (Kl 9)
8) 24. Juni 2013 – Wolkensteins geistliche Lieder: Die neuartigen Text-Bild-Verhältnisse in Wolkensteins Marienliedern Kl 78, Kl 120 und Kl 34
9) 08. Juli 2013 – Wolkensteins Religiosität: Gefangenschaft, Folter, Todesangst und Höllenvorstellung Kl 1, Kl 6, Kl 7 und Kl 32)
Hier finden Sie
nachfolgend:
3. Kommentar
4. Sekundärliteratur (in
Auswahl der Vorlesungsthemata)
5. Diskographie
1. Textgrundlage
1.1 Standardausgabe
Die Lieder Oswalds von
Wolkenstein-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von Walter Weiss und Notburga Wolf
hrsg. von Karl Kurt Klein. Musikanhang von Walter Salmen. Tübingen 1962, 3.,
neubearbeitete und erweiterte Auflage von Hans Moser, Norbert Richard Wolf und
Notburga Wolf. Tübingen 1987 u.ö. (= Altdeutsche Textbibliothek 55)
1.2 Alternative zur
Standardausgabe
Oswald von Wolkenstein: Lieder.
Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählte Texte hrsg., übers. und
kommentiert von Burghart Wachinger. Melodien und Tonsätze hrsg. und kommentiert
von Horst Brunner. Stuttgart 2007 (= RUB 18490).
Alle Texte zu Oswald von Wolkenstein stehen zum kostenlosen
Download auf der Homepage der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft bereit:
www.wolkenstein-gesellschaft.com/texte_oswald/php
Weiteres Material
stellt das Archiv
der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft
an der Karl-Franzens-Universität Graz zur
Verfügung. Dieses Grazer Wolkenstein-Archiv befindet sich in der
Nachlass-Sammlung der UB Graz und wird
seit der Emeritierung von Anton Schwob (2005) von Wernfried Hofmeister betreut.
Bereits online aufzurufen sind u.a.: der Bestand des Archivs, der Kommentar von Werner
Marold (1926) sowie die Gesamtedition der Melodien durch
Oswald Koller (1902).
2. Gesamtübersetzung
Oswald
von Wolkenstein: Das poetische Werk. Gesamtübersetzung in neuhochdeutsche Prosa
mit Übersetzungskommentaren und
Textbibliographien von Wernfried Hofmeister. Berlin: De
Gruyter Verlag 2011.
3. Kommentar
Werner
MAROLD: Kommentar zu den Liedern Oswalds von Wolkenstein. Hrsg. von Alan
ROBERTSHAW. Innsbruck 1995 [Jetzt im Grazer
‘Wolkenstein-Archiv’ online aufzurufen – hier
klicken!]
4. Sekundärliteratur (Auswahl – chronologisch)
MÜLLER, Ulrich: "Dichtung"
und "Wahrheit" in den Liedern OsvW: Die autobiographischen Lieder von
den Reisen. Göppingen 1968 (GAG 1).
SCHWOB, Anton: Oswald von Wolkenstein.
Eine Biographie. Bozen 1977.
SCHWOB, Anton u.a. (Hrsg.): Die
Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein, Edition und Kommentar, 4 Bände. Wien,
Köln 1999 / 2000 / 2004/ 2011.
HARTMANN, Sieglinde: Oswald von
Wolkenstein heute: Traditionen und Innovationen in seiner Lyrik. In: JOWG 15
(2005), S. 349-372.
SPICKER, Johannes: Oswald von
Wolkenstein. Die Lieder. Berlin 2007 (= Klassiker Lektüren 10).
HARTMANN, Sieglinde: Oswald von
Wolkenstein, in: Kindlers Literatur-Lexikon. 3., völlig neu bearbeitete
Auflage. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Stuttgart /Weimar 2009, Band 12,
418-420.
MÜLLER, Ulrich / SPRINGETH, Margarethe
(Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk – Rezeption. Berlin 2011 (mit
Gesamtbibliographie und Forschungsbericht).
HARTMANN, Sieglinde: Die deutsche
Liebeslyrik vom Minnesang bis zu Oswald von Wolkenstein oder Die Erfindung der
Liebe im Mittelalter. Wiesbaden 2012 (= Einführung in die deutsche Literatur
des Mittelalters, Band 1).
5. Diskographie
bzw. Einspielungen
SCHUBERT, Martin: Einspielungen von
Liedern Oswald von Wolkenstein. Mit einer Diskographie. In: MÜLLER, Ulrich /
SPRINGETH, Margarethe (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin 2011, 313-329.
Diskographie zusammengestellt von
Christine Müller auf:
http://www.wolkenstein-gesellschaft.com/diskographie.php

Unbekannter Maler, Oswald von Wolkenstein, Innsbrucker
Liederhandschrift von 1432, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Erstes
lebensechtes und lebensgroßes Porträt eines deutschsprachigen Autors
Prof.
Dr.
Hauptseminar
WS 2012/2013
Übungsraum
24 im Phil.-Gebäude
Zeit:
montags 16.00-19.00 Uhr, Beginn: 22.10.2012
Der 'Gregorius’ des
Hartmann von Aue und die Wiederkehr des Ödipusmythos
Bitte neuen Studienführer mit studienrelevanten Informationen inklusive Kursbeschreibungen auf der Homepage des Würzburger Instituts beachten: Studiumsführer
Zu
den gelungensten Neuformungen antiker Mythenstoffe im Hochmittelalter
zählt Hartmanns Verserzählung von einem sagenhaften Papst Gregor
– obwohl der höfische Epiker seine Vorlage, die altfranzösische
Legende, ohne nachweisliche Kenntnisse des antiken Ödipus-Mythos aufgegriffen
hat. Gegenüber der antiken Form der Tragödie und dem damit eng
verbundenen Glauben an ein von Göttern verhängtes Schicksal
entwickelt der mittelalterliche Autor Erzählstrategien, welche es seinem
Protagonisten erlauben, einen für die Menschheit neuartigen Weg der
‚Katharsis’ zu finden.
Um
die Zusammenhänge von neuem christlichen Menschenbild und höfischer
Erzählkunst zu erfassen, werden wir Hartmanns ‚Gregorius’ aus
der Perspektive der Ödipus-Mythen der Antike in den Blick nehmen. Im
Gegenlicht der antiken Modelle werden wir sodann erarbeiten, wie der
mittelalterliche Epiker eine innere Umgestaltung der antiken Mythenmotive
erreicht. Unsere Hauptaufgabe wird es mithin sein zu erfragen, wie Hartmann von
Aue die Handlung strukturiert, wie er die Funktion der narrativen Instanz ausfüllt,
mit welchen erzählerischen Mitteln er das
Geschehen strukturiert und vorantreibt und wie er den Charakter seines
Titelhelden zu dem neuartigen ‚Heldentyp’ eines sündigen
Heiligen ausformt.
Textgrundlage:
Hartmann von Aue. Gregorius. Nach
dem Text von Friedrich Neumann neu herausgegeben, übersetzt und
kommentiert von Waltraud Fritsch-Rößler.
Stuttgart 2011 (Reclams UB 18764) - mit
neuester Sekundärliteratur,
oder
Hartmann von Aue. Gregorius. Der
Arme Heinrich. Iwein. Herausgegeben und
übersetzt von Volker Mertens. Frankfurt am Main 2008 (= Deutscher
Klassiker Verlag im Taschenbuch, Band 29) – ausführlichster Stellenkommentar
und aktualisierte Auswahl-Bibliographie.
Gregorius von Hartmann von Aue. Hrsg.
von Hermann Paul, neu bearbeitet von Burghart Wachinger.
15., durchgesehene und erweiterte Auflage. Tübingen 2004 – einsprachige Ausgabe mit wenigen
Erläuterungen, aber beste Übersicht über Überlieferung,
Seite VII-XV.
Quellen:
Hartmann von Aue, Gregorius. Die Überlieferung des Prologs, die Vaticana-Handschrift A und eine Auswahl der übrigen
Textzeugen in Abbildungen herausgegeben und erläutert von Norbert Heinze.
Göppingen 1974 (= Litterae Nr. 28) – schwarz-weiß-Faksimile
der Textüberlieferung.
Digitalisat der
Leithandschrift A in der
Apostolischen Bibliothek des Vatikan (Signatur: Rom, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Cod. Regin. Lat.
1354) aufrufbar über Nachweis in: Handschriftencensus.
Marburger Repertorium. Deutschsprachige Handschriften
des 13. und 14. Jahrhunderts:
http://www.fgcu.edu/rboggs/Hartmann/Gregorius/GrImages/GrGetImagesA.asp
Textausgabe
der altfranzösischen Vorlage:
La vie du pape Saint Grégoire ou
La Légende du bon pécheur. Leben des heiligen Papstes Gregorius
oder die Legende vom guten Sünder. Text nach der Ausgabe von Hendrik
Bastian Sol mit Übersetzung und Vorwort von Ingrid Kasten. München
1991 (= Klassische Texte des romanischen Mittelalters in zweisprachigen
Ausgaben 29).
Vollständige Bibliographien bzw. Monographien:
Elfried Neubuhr: Bibliographie zu Hartmann von Aue. Berlin 1976.
Hartmann
von Aue. Mit einer Bibliographie. Hrsg. von Petra Hörner. Frankfurt am
Main et al. 1998.
Christopf Cormeau und Wilhelm Störmer:
Hartmann von Aue. Epoche – Werk
– Wirkung. 3. Aufl. München 2007.
Jürgen Wolf: Einführung in
das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007 – nicht ohne Fehler, aber neueste Monographie.
Neuere
Sekundärliteratur zu mediävistischer Erzählforschung (Narratologie)
und zur literaturwissenschaftlichen Intertextualität:
Überblick
im Artikel „Narratologie“ in: Metzler Lexikon Literatur. 3. Aufl.
Stuttgart / Weimar 2007.
Ulrich
Broich: Intertextualität. In: Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung. Band 2. Berlin 2000, 175-179.
Gérard
Genette: Die Erzählung. 3., durchgesehene und korrigierte Auflage
übersetzt von Andreas Knop mit einem Nachwort
von Jochen Vogt überprüft und berichtigt von Isabel Kranz.
München 2010.
Wolfram-Studien XVIII.
Erzähltechnik und Erzählstrategien in der deutschen Literatur des
Mittelalters. Saarbrücker Kolloquium 2002. Hrsg. von Wolfgang Haubrichs, Eckart C. Lutz, Klaus Ridder.
Berlin 2004; darin Einleitung sowie
die folgenden Beiträge:
Monika Unzeitig: Von der
Schwierigkeit zwischen Autor und Erzähler zu unterscheiden. Eine
historisch vergleichende Analyse zu Chrétien
und zu Hartmann. In: Wolfram-Studien XVIII. Berlin 2004, 59-81.
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
Monika
Unzeitig: Autorname und Autorschaft: Bezeichnung und Konstruktion in der
deutschen und französischen Erzählliteratur des 12. und 13.
Jahrhunderts. Berlin/New York 2010.
Historische
Narratologie – Mediävistische Perspektiven. Hrsg. v. Haferland,
Harald / Meyer, Matthias. Berlin/New York 2010.
Armin
Schulz: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. Berlin/New York
2012.
Neuere
Sekundärliteratur zur literaturwissenschaftlichen und zur
mediävistischen Mythosforschung:
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008.
Band
1: Herrscher Helden Heilige; darin Einleitung, sowie ARTIKEL zu Karl der
Große, Sankt Georg, Der Heilige Franz von Assisi; Band 2: ARTIKEL zum
Teufel; Band 3: ARTIKEL Judas Ischariot.
ARTIKEL
‚Mythologie’ und ‚Mythos’, in:
Metzler Lexikon Literatur. 3. Aufl. Stuttgart / Weimar 2007 (= grundlegende literaturwissenschaftliche
Definition).
Neuere
Sekundärliteratur zur Diskussion über Helden und Heilige:
Bernd
Bastert: Helden als Heilige. Chanson de geste-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Tübingen
2010 (besonders: Vorwort).
Helden
und Heilige: kulturelle und
literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Hrsg. von
Andreas Hammer. Heidelberg 2010 (besonders:
Vorwort) sowie darin
Jing Xuan: Erzählen im Schwellenraum: Die Legende des
sündigen Hl. Grégoire, Seite 197-214.
Ulrich
Müller: Heldenbilder der Antike und des europäischen Mittelalters:
Eine tour d’horizon. In: Das Nibelungenlied und das Buch des Dede
Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des
zweiten interkulturelles Symposiums in Mainz,
Deutschland, 2011. Herausgegeben von Kamal M. Abdullayev, Hendrik Boeschoten
und
Im Folgenden verweise ich
nur auf die wichtigsten (neueren) Titel, weitere Sekundärliteratur muss
selbst zu dem betreffenden Thema recherchiert werden!
Sitzungsplan
1) 22.10.2012 – Einführung, Erläuterung des
Seminarplans, Verteilung der Referate / Hausarbeiten
2) 29.10.2012
– Hartmanns
Prolog, die afz. Vorlagen und die Gattungsproblematik
Themen:
a) Die afz. Vorlagen zu Hartmanns
‚Gregorius’, die Überlieferung von Hartmanns
‚Gregorius’ und die bisherigen Versuche der Gattungsbestimmung
Sekundärliteratur:
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007, dort bibliogr. Nachweise;
Zusammenfassung
der Diskussion im Vorwort der Ausg. der afrz. Legende
von I. Kasten sowie Nachwort der Ausgaben von W. Fritsch-Rößler
+ V. Mertens;
Fritz
Peter Knapp: legenda aut
non legenda. Erzählstrukturen und
Legitimationsstrategien in ‚falschen’ Legenden des Mittelalters:
Judas – Gregorius – Albanus. In: Germanisch-Romanische
Monatsschrift. 53. 2003, 133-154.
b)
Der Prolog des ‚Gregorius’: Inhaltlicher Aufbau, rhetorische
Gestaltung und narrative Funktion
Sekundärliteratur:
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007 –
dort Erläuterungen + Literaturhinweise + Kommentare in den Editionen von Fritsch-Rößler und Mertens.
3) 05.11.2012
– Die Handlungsstruktur des ‚Gregorius: Antike
und mittelalterliche Muster einer Heldenbiographie
Themen:
a) Der Ödipus-Mythos von der griechischen Antike bis zum Mittelalter
– eine stoffgeschichtliche Zusammenfassung
Sekundärliteratur:
Artikel
ÖDIPUS in: Elisabeth Frenzel: Stoffe der
Weltliteratur. 10. Aufl. Stuttgart 2005.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
Mythos Ödipus. Texte von Homer bis
Pasolini. Hrsg. von Nikola Rossbach. Leipzig 2005 – Textsammlung mit
Erläuterungen.
b) Heilige
Helden des Mittelalters und ihre Gestaltung in der deutschen Literatur des
Mittelalters: Karl der Große (‚Rolandslied’ des Pfaffen
Konrad), Hl. Gregorius (Hartmann von Aue) und Hl. Georg (Konrad von
Würzburg)
Sekundärliteratur:
Ulrich Wyss: Legenden, in: Epische Stoffe des Mittelalters. Hrsg.
von Volker Mertens und Ulrich Müller. Stuttgart 1984;
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 1: Herrscher Helden Heilige; darin Einleitung, sowie
ARTIKEL zu Karl der Große, Sankt Georg.
Bernd
Bastert: Helden als Heilige. Chanson de geste-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Tübingen
2010 (besonders: Vorwort).
Ulrich
Müller: Heldenbilder der Antike und des europäischen Mittelalters:
Eine tour d’horizon. In: Das Nibelungenlied und das Buch des Dede
Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des
zweiten interkulturellen Symposiums in Mainz,
Deutschland, 2011. Herausgegeben von Kamal M. Abdullayev, Hendrik Boeschoten
und
4) 12.11.2012
– Der Handlungsbeginn im ‚Gregorius’ und die Rolle des
Erzählers
Themen:
a)
Die Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler in den Erzählwerken
Hartmanns von Aue: ‚Erec’, ‚Iwein’, ‚Gregorius’ und ‚Armer
Heinrich’
Sekundärliteratur:
Monika
Unzeitig: Von der Schwierigkeit zwischen Autor und Erzähler zu
unterscheiden. Eine historisch vergleichende Analyse zu Chrétien
und zu Hartmann. In: Wolfram-Studien XVIII. Berlin 2004, 59-81.
b)
Die Funktion des Erzählers in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Cornelia
Johnen: Analyse der narrativen Funktion des Erzählers in Hartmanns von Aue
‚Gregorius’. München 2011 (Online-Ressource).
5) 19.11.2012 – Inzestgeburt
des ‘neuen’ Helden: die Eltern zwischen Selbstbestimmung und
Fremdbestimmung – Vers 451-500
Themen:
a)
Inzest im mittelalterlichen Recht und in den mittelalterlichen Legenden von den
Inzest-Heiligen Metro von Verona, Albanus und Gregorius
Sekundärliteratur:
Artikel
INZEST in: Elisabeth Frenzel: Motive der
Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
Artikel
INZEST in Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte + Lexikon des
Mittelalters.
Alexandra
Rassidakis: Von Liebe und Schuld. Inzest in Texten
von Hartmann von Aue, Th. Mann und Jeffrey Eugenides.
In: literatur für leser.
2005, 65-84.
b)
Gestaltung des Geschwisterinzests in der afz. ‚Vie
du pape saint Grégoire’ und in Hartmanns
‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte
Herlem-Prey: Le ‚Gregorius’ et la
‚Vie de Saint Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen 1979.
Alexandra
Rassidakis: Von Liebe und Schuld. Inzest in Texten
von Hartmann von Aue, Th. Mann und Jeffrey Eugenides.
In: literatur für leser.
2005, 65-84.
6)
26.11.2012 – Aussetzung des Kindes in antiken
Ödipusmythen, in der
Bibel, in den altnordischen Siegfriedsagen und bei
Hartmann – Vers 924-938 + 1008-1033
Themen:
a)
Aussetzung des Kindes in antiken Ödipus-Mythen, in der Bibel (Moses), in
römischen Mythen von Romulus und Remus und in der ‚Thidrekssaga’ (Sigurd/Siegfried)
Sekundärliteratur:
Artikel
HERKUNFT, Die unbekannte in: Elisabeth Frenzel:
Motive der Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
FitzRoy Richard Somerset Raglan: The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama.
Materialen
zu meiner Vorlesung mit vergleichender Motivtabelle Ödipus –
Gregorius.
b)
Die Aussetzung des Kindes in der afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’
und in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Joachim
Theisen: Des Helden bester Freund. Zur Rolle Gottes bei Hartmann von Aue,
Wolfram und Gottfried. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches in
geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 153-169.
Hausmann,
Albrecht: Gott als Funktion erzählter Kontingenz: Zum Phänomen der
„Wiederholung“ in Hartmanns von Aue ‚Gregorius. In: Kein
Zufall: Konzeptionen von Kontingenz in der
mittelalterlichen Literatur. Hrsg. von Cornelia Herberichs.
Göttingen 2010, 79-109
7) 03.12.2012 – Gregorius’
Jugend und die Entdeckung seiner
Findlingsherkunft: Einbruch
neuer mythischer Motive? Vers 1285-1335 + 1359-1374
Themen:
a) Muster von Kindheit und Jugend in Hartmanns ’Gregorius’,
in Gottfrieds ‚Tristan’ und in Wolframs ‚Parzival’
Sekundärliteratur:
Matthias
Winter: Kindheit und Jugend im Mittelalter.
Madeleine Pelner
Cosman: The Education of the Hero in Arthurian Romance.
David A. Wells: Fatherly Advice. The Precepts of ‘Gregorius’, Marke, and Gurnemanz and the
School Tradition of the (Disticha Catonis’.
(…).
In: Frühmittelalterliche Studien. 28. 1994, 296-332.
b) Heldenjugend und Entdeckung der Findlingsherkunft im antiken
Ödipus-Mythos, in der mittelalterlichen Judaslegende, in Hartmanns
‚Gregorius’ und ihre Funktion im Handlungsverlauf
Sekundärliteratur:
Artikel
HERKUNFT, Die unbekannte in: Elisabeth Frenzel:
Motive der Weltliteratur. 6. Aufl. Stuttgart 2008.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, 165-199.
8) 10.12.2012 – Das Streitgespräch zwischen dem Abt und Gregorius und
die 1. Ausfahrt des Helden Vers 1385-1850
Themen:
a)
Die mittelalterliche Gattung des Streitgesprächs und die Struktur des
Streitgesprächs zwischen Abt und Gregorius bei Hartmann
Sekundärliteratur:
Paul
Michel: Mit Worten tjôstieren. Argumentationsanalyse
des Dialogs zwischen dem Abt und Gregorius bei Hartmann von Aue. In:
Germanistische Linguistik. 1979, 195-215.
Anja
Becker: Die göttlich geleitete Disputation: Versuch einer
Neuinterpretation von Hartmanns ‚Gregorius’ ausgehend vom Abtgespräch. In: Disputatio
1200-1800: Form, Funktion und Wirkung eines
Leitmediums universitärer Wissenskultur. Hrsg. von Marion Gindhart und Ursula Kundert. Berlin/New
York 2010, 331-361.
b)
Die Bewertung der ritterlichen Lebensform aus Sicht des Abtes und aus Sicht des
Gregorius in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Hans-Georg
Reuter: Die Lehre vom Ritterstand. Zum Ritterbegriff in Historiographie und
Dichtung vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. 2. Aufl. Köln, Wien 1974.
Kerstin
Schmitt: Körperbilder, Identität und Männlichkeit im ‚Gregorius’.
In: Genderdiskurse und Körperbilder im
Mittelalter. (…). Hrsg. von Ingrid Bennewitz
und Ingrid Kasten. Münster 2002, 135-155.
9) 17.12.2012 – Gregorius’ 1. Begegnung mit der
Mutter und seine 1. Heldentat; Heirat und inzestuöses Eheleben –
Vers 1894-2518
Themen:
a)
Das Motiv des Sehens und die narrative Fokalisierung in der 1. Begegnungsszene
mit Mutter und Sohn
Sekundärliteratur:
Artikel
QUINQUE LINEAE AMORIS, in: Sachwörterbuch der Mediävistik. Hrsg. von
Peter Dinzelbacher. Stuttgart 1992.
Gerhard
Wolf: Sieht man mit dem ‚inneren Auge’ besser? Zu Formen und
Funktion visueller Wahrnehmung im mittelniederländischen ‚Roman van Walewein’. In: Sehen und Sichtbarkeit in der
Literatur des deutschen Mittelalters. XXI. Anglo-German
Colloquium London 2009. Hrsg. von Ricarda Bauschke,
Sebastian Cox, Martin H. Jones. Berlin 2011, 211-227.
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
b)
Erste Heldentat und der Mutter-Sohn-Inzest im antiken Ödipus-Mythos, in der
afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’ und
in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
10)
07.01.2013 – Die
Entdeckung des Inzests, die biblischen Beispielfiguren
(Judas und
König David), die Buße der Mutter und die Trennung des Paares
– Vers 2519-2747
Themen:
a) Die narrative Funktion der biblischen Beispielfiguren bei der
Entdeckung des Inzests im Kontext der extradiegetischen
Bemerkungen in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Ulrich Ernst: Der
‚Gregorius’ des Hartmann von Aue. Theologische Grundlagen – legendarische Strukturen – Überlieferung im
geistlichen Schrifttum. Köln 2002.
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 3: ARTIKEL Judas Ischariot.
Hartmut Freytag: „diu seltsaenen maere / von dem guoten sündaere“. Über die heilsgeschichtlich
ausgerichtete interpretatio auctoris
im ‚Gregorius’ Hartmanns von Aue. In: Euphorion.
98. 2004, 265-281.
b) Die Funktion des Teufels bei den Inzesten in der afz. ‚Vie du pape saint Grégoire’ und
in Hartmanns ‚Gregorius’
Sekundärliteratur:
Brigitte Herlem-Prey:
Le ‚Gregorius’ et la ‚Vie de Saint
Grégoire’. Détermination de la source de Hartmann von Aue à partir de
l’étude comparative intégrale des textes. Göppingen
1979.
Arnold
Angenendt: Geschichte der Religiosität im
Mittelalter. Darmstadt 1997, Kapitel „Engel und Teufel.
Ingrid
Kasten im Vorwort zur afz. Textausgabe.
Mittelalter-Mythen.
Hrsg. von Ulrich Müller und Werner Wunderlich. 5 Bände. St. Gallen /
Konstanz 1990-2008; Band 2: ARTIKEL zum Teufel.
11)
14.01.2013 – Strafe
für den Inzest: Gregorius’ 2. Heldentat (Buße) und seine
Verwandlung in
einen Heiligen – Vers 2751-3144.
Themen:
a)
Gregorius’ 2. Ausfahrt und die narrative Gestaltung der Verwandlung in
einen Heiligen
Sekundärliteratur:
Peter
Strohschneider: Inzest-Heiligkeit. Krise und Aufhebung der Unterschiede in
Hartmanns ‚Gregorius’. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches
in geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 105-133.
Harald
Haferland: Metonymie und metonymische Handlungskonstruktion erläutert an
der Konstruktion von Heiligkeit in zwei mittelalterlichen Legenden. In: Euphorion. 99. 2005, 323-365.
b)
Verwandelt der Erzähler Gregorius tatsächlich in einen heiligen Eremiten?
Eine kritische Sichtung der Forschung, speziell von V. Mertens Monographie
Sekundärliteratur:
Erhard
Dorn: Der sündige Heilige in der Legende des Mittelalters. München
1967.
Peter
Strohschneider: Inzest-Heiligkeit. Krise und Aufhebung der Unterschiede in
Hartmanns ‚Gregorius’. In: Geistliches in weltlicher und Weltliches
in geistlicher Literatur. Hrsg. von Christoph Huber u.a.
Tübingen 2000, 105-133.
12) 21.01.2013
– Gregorius’ Erwählung zum Papst und die Wunder seiner 2.
Auffindung: neues Heiligenideal – Vers 3137-3830
Themen:
a)
Die Funktion der Fischer als Handlungsträger in Hartmanns
‚Gregorius’
b)
Gregorius und sein neues Heiligenideal im Kontext der mittelalterlichen Heiligenverehrung
Sekundärliteratur:
Peter
Dinzelbacher / Dieter Bauer (Hrsg.): Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. Ostfildern
1990, 10-17.
Artikel
HEILIGE, in: Lexikon des Mittelalters.
Helden
und Heilige: kulturelle und
literarische Integrationsfiguren des europäischen Mittelalters. Hrsg. von
Andreas Hammer. Heidelberg 2010 (besonders:
Vorwort) sowie darin
Jing Xuan: Erzählen im Schwellenraum: Die Legende des
sündigen Hl. Grégoire, Seite 197-214.
13)
28.01.2013 – Die
Zusammenführung von Mutter und Sohn im ‚Gregorius’:
Das Ende des mythischen Heros
Ödipus und des heiligen Heros Gregorius – Vers 3831 - 4006
Themen:
a)
Das Motiv des Sehens und die narrative Fokalisierung in der 2. Begegnungsszene
mit Mutter und Sohn
Sekundärliteratur:
Gert
Hübner: Fokalisierung im höfischen Roman. In: Wolfram-Studien XVIII.
Berlin 2004, 127-150.
b)
Das Ende des mythischen Heros
Ödipus und des heiligen Helden Gregorius – eine christliche
Überwindung antiker Tragik?
Sekundärliteratur:
Huber,
Christoph: Mittelalterliche Ödipus-Varianten. In: Festschrift Walter Haug
und Burghart Wachinger. Hrsg. von Johannes Janota. Band I, Tübingen 1992, S.165-199.
WEITERE MATERIALIEN WERDEN AUF DIESER HOMEPAGE ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT!
Vorlesung Sommersemester 2012 Prof. Dr. SIEGLINDE HARTMANN
Der
‘Gregorius’ des Hartmann von Aue und die Wiederkehr des Ödipusmythos
Beginn der
Lehrveranstaltungen: Montag 23. April 2012
Ort:
Philosophiegebäude Hörsaal 2
Mittelalter-Mythen zu erforschen gehört zu den
jüngsten Forschungsfeldern der Mediävistik. Neben dem Wiederaufleben von
germanischen und keltischen Mythen, stellt uns besonders die
hochmittelalterliche Wiederkehr von Mythen aus der griechischen und römischen
Antike vor zahlreiche ungelöste Rätsel. Auffällig, aber weitgehend ungeklärt,
bleibt unter anderem, dass die gelungensten Beispiele einer inneren Umformung
antiker Mythen und ihrer Zentralgestalten im Medium der neuen literarischen
Gattungen höfischer Erzählkunst entstanden sind.
Ohne nachweisliche Kenntnis des antiken
Ödipus-Mythos hat der höfische Epiker Hartmann von Aue gegen Ende des 12.
Jahrhunderts die mittelalterliche, altfranzösische Legende von einem
sagenhaften Papst Gregor aufgegriffen, um an seinem Schicksal darzulegen, welch
gnadenhafte Wendung eine inzestuöse Mutter-Sohn-Beziehung erfahren kann.
Gegenüber der antiken Form der Tragödie und dem damit eng verbundenen Glauben
an ein von Göttern verhängtes Schicksal entwickelt der mittelalterliche Autor
Erzählstrategien, welche es seinem Protagonisten erlauben, einen für die
Menschheit neuartigen Weg der ‘Katharsis’ zu finden.
In der Vorlesung soll daher Hartmanns
Verserzählung im Gegenlicht der antiken Modelle beleuchtet werden, um
herauszufinden, wie der mittelalterliche Erzähler eine innere Umgestaltung der
antiken Mythenmotive erreicht.
Gleichzeitig soll gezeigt, wie der deutsche
Epiker Hartmann seine altfranzösische Vorlage in einigen Handlungsmotiven so
umgestaltet, dass die inneren Wandlungen seines Protagonisten plastischer
profiliert erscheinen und am Ende in eine christliche Remythisierung der
antiken Ödipusfabel münden.
Aus dieser Perspektive wird die Vorlesung einen
Überblick über die wesentlichen Interpretationsprobleme bieten, wie sie die
aktuelle mediävistische Forschung zu Hartmanns ‘Gregorius’ beherrschen.
Textgrundlage: Hartmann von Aue. Gregorius. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch.
Nach dem Text von Friedrich Neumann neu herausgegeben, übersetzt und
kommentiert von Waltraud Fritsch-Rößler. Stuttgart 2011 [Reclams UB 18764].
Zur Einführung:
Christoph Cormeau: Hartmann von Aue, in: Die
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Band 3, Spalten 500-520;
Christoph Cormeau und Wilhelm Störmer: Hartmann
von Aue. Epoche – Werk – Wirkung. 3. Aufl. München 2007.
Francis
G. Gentry: A Companion to the Works of Hartmann von Aue. Rochester et. al. 2005.
Ulrich Müller, Werner Wunderlich (Hrsg.):
Mittelalter-Mythen. Band 1: Herrscher, Helden, Heilige. St. Gallen 1996,
Einleitung, S. IX-XIV.
Jürgen
Wolf: Einführung in das Werk Hartmanns von Aue. Darmstadt 2007.
SPRECHSTUNDE:
MONTAGS 14.00 bis 15.00 Uhr
Folgende Terminübersicht zeigt an, zu welchem Zeitpunkt und Frist die Anmeldung zu Prüfungen getätigt werden kann:
VORLESUNGSPLAN
1)
Montag 23. April 2012
Einführung: Hartmann von Aue und sein ‘Gregorius’
2) Montag 30. April 2012
Die mittelalterliche Legende und der antike Mythos:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
3)
Montag 07. Mai 2012
Inzestgeburt des
‘neuen’ Helden: die Eltern zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung – Vers
451-500
Materialien Literatur + Definitionen VL 3
4)
Montag 14. Mai 2012
Auffindung des
Kindes in antiken Ödipusmythen, in der Bibel und bei Hartmann – Vers 924-938 +
1008-1033
5)
Montag 21. Mai 2012
Gregorius’
Jugend und seine erste Missetat: Einbruch mythischer Motive? Vers 1285-1335 +
1359-1374
6)
Montag 04. Juni 2012
Gregorius’ 1.
Ausfahrt und Begegnung mit der Mutter: das mythische Motiv der Blindheit und
seine christliche Umdeutung – Vers 1894-1969
7)
Montag 11. Juni 2012
Gregorius zweite
Missetat: sein inzestuöses Eheleben und das Motiv der allmorgendlichen Buße –
Vers 2224-2294
8)
Montag 18. Juni 2012
Die Entdeckung
des Inzests und die biblischen Beispielfiguren sündiger Verzweiflung – Vers
2589-2663
9)
Montag 25. Juni 2012
Strafe für den
Inzest: Ödipus und sein Sohn Polyneikes, Gregorius’ Buße und der Fischer – Vers
3274-3370
10)
Montag 2. Juli 2012
Die 2. Auffindung des Gregorius und das neue ‘Heldenideal’ des “gottes trût” – Die
Metamorphose antiker Heroen in selbstbestimmte christliche Helden
MATERIALIEN ZUR VORLESUNG
STEHEN AUF MEINER
HOMEPAGE ZUM DOWNLOAD BEREIT:
http://www.sieglinde-hartmann.com
BUTTON: Academic Program
Prof. Dr.
Sieglinde Hartmann
Hauptseminar
WS 2011/2012
Mit
Gastkonzert von Dr. Silvan Wagner
(Universität
Bayreuth) am 06.02.2012
Raum: 2.003
im Zentralen Hörsaal- und
Seminargebäude
Zeit: montags
16.00-18.30 Uhr, Beginn: 24.10.2011
DIE DEUTSCHE
LIEBESLYRIK VOM KÜRENBERGER BIS ZU OSWALD VON WOLKENSTEIN
Bis
heute bleibt erstaunlich, wie rasch sich die erste profane Liebesdichtung in
deutscher Sprache seit der Mitte des 12. Jahrhunderts unter dem Einfluss der
höfisch ritterlichen Dichtung nach französischem Vorbild zu einer
eigenständigen, bis heute unübertroffen variantenreichen Liedkunst entfaltet
hat. Besonders faszinierend wirkt, mit welch nachhaltiger Suggestivkraft die
deutschen Minnesänger die profane Liebe zum alles beherrschenden Thema
entwickelt haben, welches das Geschlechterverhältnis weit über ihre Zeit hinaus
prägen sollte.
Ziel
des Hauptseminars ist es, den poetischen Erfindungsreichtum und die
Originalität der einzelnen Dichterpersönlichkeiten anschaulich zu machen. Daher
sollen charakteristische Lieder aller Entwicklungsphasen vom frühen ‘donauländischen’ Minnesangs (von ca. 1150) bis zu Oswald
von Wolkenstein (ca. 1410-1430) in Einzelanalysen erarbeitet werden. Die
Liedauswahl soll gleichzeitig dazu dienen, die mittelalterliche deutsche
Liebeslyrik in ihrer gattungstypischen Entfaltung, metrischen Baukunst und
überlieferungsgeschichtlichen Eigenart zu erhellen.
Ein
Leistungsnachweis kann aufgrund eines Referats (+ schriftliche Fassung) oder
mittels einer Hausarbeit erworben werden.
S i t z u n g s p l a n
1)
24.10.2011 – Einführung: Entstehung des Minnesangs und Entwicklungsphasen der
Liebeslyrik bis zu Oswald von Wolkenstein, Überlieferung der Minnelyrik
(Budapester Fragment, Hss. A, B, C + Wolkenstein-Hss.), Sangbarkeit = höfische Liedkunst;
Erläuterung des Seminarplans, Verteilung der Referate / Hausarbeiten
2)
31.10.2011 – Der Kürenberger und der ‘Donauländische Minnesang’
Themen:
a) Das
‘Falkenlied’ des Kürenbergers in der Überlieferung
der Großen Heidelberger Liederhandschrift C und im Budapester Fragment;
b) Gender Aspekte bei der Liedlyrik des Kürenbergers:
Polarisierung von weiblichen und männlichen Rollen;
c) Die
Rezeption des ‘Falkenlieds’ im ‘Nibelungenlied’: Kriemhilds Falkentraum (1. Âventiure)
3)
07.11.2011 – Frühhöfischer Minnesang: Heinrich von Veldeke
(MF XII) und Kaiser Heinrich VI.
Themen:
a) Die Minne
als neue ‘Göttin’ der Liebe bei Heinrich von Veldeke
– Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation des Liedes MF XII;
b) Das Lob
Gottfrieds von Straßburg auf Heinrich von Veldeke und
die Einführung französischer Formkunst sowie der Konzeption der Hohen Minne in
den deutschen Minnesang;
c) Kaiser
Heinrich VI. als Minnesänger: ein Profil seiner Persönlichkeit als Kaiser und
als Minnesänger mit Interpretation des Liedes MF III.
4) 14.11.2011 –
Friedrich von Hausen: Hohe Minne, ‘Fernliebe’ und Kreuzzugslyrik
Themen:
a) Die
Konzeption der Hohen Minne bei Friedrich von Hausen: Übersetzung, metrisches
Schema und Interpretation des Liedes MF XIV;
b) Kaiser
Friedrich Barbarossas Kreuzzug (1187-1192), die Kreuzzugsteilnahme Friedrichs von
Hausen und seine Bearbeitung des französischen Kreuzzugsliedes ‘Ahi, Amours!’ im Lied MF VI.
5)
21.11.2011 – Albrecht von Johansdorf: Kreuzzugslyrik und
‘Herzensliebe’
Themen:
a) Albrecht
von Johansdorf und die ‘Herzensliebe’: Überlieferung
und inhaltliches Profil seiner Lieddichtungen mit Fokussierung auf Lied MF VIII
‘Wie sich minne hebt, daz weiz ich wol’;
b) Die
Kreuzzugsthematik bei Albrecht von Johansdorf und
Friedrich von Hausen: Parallelen und Unterschiede in ihrer Bearbeitung des
französischen Kreuzzugsliedes ‘Ahi, Amours!’.
6)
28.11.2011 – Hartmann
von Aue MF XV: ‘Unmutslied’
Themen:
a) Hartmann
von Aue und die Relevanz der Minnethematik in seinen höfischen Romanen ‘Erec’ und ‘Iwein’;
b) Hartmann
von Aue: der erste Kritiker der Hohen Minne? Eine Interpretation mit
Übersetzung und metrischem Schema des ‘Unmutsliedes’ (MF XV).
7) 05.12.2011 – Wolfram
von Eschenbach: Tagelieder
Themen:
a)
Wolfram von Eschenbach, sein episches Werk und die Relevanz der Minnethematik
in seinem höfischen Roman ‘Parzival’;
b) Das Tagelied
im deutschen Minnesang: Herkunft und Profil einer Liedgattung vom Minnesang bis
zu Oswald von Wolkenstein;
c)
Wolframs Tagelied ‘Sîne klâwen’
– Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
Literatur und Arbeitsbücher zur deutschen Literatur des Mittelalters
8)
12.12.2011 – Heinrich von Morungen: Tagelieder und ‘Traumliebe’
Themen:
a) Heinrich
von Morungen, Überlieferung und thematische Schwerpunkte seiner Lieddichtungen;
b) Heinrich von
Morungen und seine Poetik des Schauens: Übersetzung, metrisches Schema und
Interpretation des Lieds MF XIII;
c) Das
Tagelied ‘Owê’ (MF XXX) Heinrichs von Morungen und
seine Bildregie: Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
9)
19.12.2012 – Heinrich von Morungen: ‘Narzisslied’ – südfranzösisches Vorbild
und Antikenrezeption
Themen:
a) Die
Rezeption antiker (römischer und griechischer) Mythenstoffe in der höfischen
Literatur und im Minnesang: Heinrich von Veldekes Eneasroman und die Ovid-Rezeption im Minnesang;
b) Der antike Mythos von Narziss und seine
Wiederaufnahme im ‘Narzisslied’ bei Heinrich von Morungen und seinem anonymen
französischen Vorbild.
Titelblatt+Gliederung Hausarbeit
Gebrüder Grimm: Möringers Wallfahrt
10)
09.01.2012 – Reinmar: Minneklagen und Minneleid
Themen:
a)
Reinmar der Alte: Überlieferung und thematisches Spektrum seiner
Lieddichtungen;
b) Reinmar als
Meister der Minneklage: Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation des
Lieds MF XV.
11) 16.01.2012 – Walther
von der Vogelweide: Lieder der Hohen Minne und das ‘Lindenlied’
Themen:
a) Walther
von der Vogelweide und die neuen thematischen Schwerpunkte seines Minnesangs:
Lieder der ‘niederen Minne’ und der ‘hohen Minne’;
b) Walther
von der Vogelweide und die Interpretationen seines ‘Lindenlieds’: Übersetzung,
metrisches Schema und kritische Reflexion der Forschung.
12) 23.01.2012 – Oswald
von Wolkenstein: Pastourellen und Tagelieder
Themen:
a) Oswald von
Wolkenstein: Überlieferung, thematische Gliederung und Innovationen seiner
Liedkunst;
b) Wolkensteins
Variationen des Tagelieds und sein ‘Antitagelied’: Übersetzung, metrisches
Schema und Interpretation des Lieds ‘Ain tunckle farb’ (Kl 33);
c) Wolkensteins
Pastourellen: Gattungsprofil am Beispiel des Liedes
‘Ain jetterin’ (Kl 83).
13) 30.01.2012 – Oswald
von Wolkenstein: Liebeslieder
Themen:
a) Liebe und
Erotik in Wolkensteins Lieddichtungen: die unterschiedlichen Liedgattungen und
ihre divergierende Wertungen;
b) Wolkensteins
Lieder an Margarete von Schwangau: Zuordnung zu Liedgattungen und Profil der
formalen wie inhaltlichen Innovationen;
c) Das
Liebesduett ‘Simm Gredlin,
Gret’ (Kl 77): Übersetzung, metrisches Schema und Interpretation.
14) 06.02.2012 Gastkonzert von Dr. Silvan Wagner (Universität Bayreuth)
Textgrundlage: Minnesang:
Mittelhochdeutsche Liebeslieder. Mhd. / Nhd. Eine Auswahl hrsg. von Dorothea
Klein. Stuttgart 2010 (= Reclam UB 18781), EUR 16,00 (mit
Auswahlbibliographie zu den Liedtexten); oder Deutsche
Gedichte des Mittelalters. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Ausgewählt,
übersetzt und erläutert von Ulrich Müller. In Zusammenarbeit mit Gerlinde
Weiss. 2. Auflage Stuttgart: 2009 ( = Reclam UB 8849); EUR 12,80 (mit Auswahlbibliographie zu den Liedtexten und Autoren). Die Texte zu
Oswald von Wolkenstein stehen zum Download auf der Homepage der Oswald von
Wolkenstein-Gesellschaft: www.wolkenstein-gesellschaft.com/texte_oswald/php.
Sekundärliteratur:
Johannes Spicker: Oswald von Wolkenstein. Die Lieder.
Berlin 2007 (= Klassiker Lektüren 10); Ulrich Müller / Margarethe Springeth (Hrsg.): Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk –
Rezeption. Berlin 2011 (mit Gesamtbibliographie). DIE
THEMEN EIGNEN SICH FÜR REFERATE UND/ODER HAUSARBEITEN.
Prof. Dr.
Sieglinde Hartmann. WS 2010/2011 Das
"Nibelungenlied" auf Basis der Hs. C S i t z u n g s p l a n Gastvortrag
(24.01.2011) von Prof. Dr. Horst Brunner (Würzburg)
über die mhd. Sangversepik und ihre Melodien, anschließend Gastkonzert: Das
‘Nibelungenlied’ in Ausschnitten dargeboten von Dr. Eberhard Kummer (Bassbariton,
Schoßharfe), 17:15-19:00 1) 25.10.2010: Einführung in Lektüre und Transkription der Hs. C +
Erläuterung der Seminararbeit Montag 1. November ist Feiertag: keine Sitzung! 2) 8.11.2010 a)
Stofftraditionen: Geschichte, Sagenkreise und altnordische Überlieferung; b) der Prolog im Mittelalter und in Hs. C – Thema für Referat
bzw. Hausarbeit; c) Interpretation der Strophen 1-11: epische Neuformung
des Nibelungenstoffs und Gliederung der Handschriften in Åventiuren 3) 15.11.2010 a) das ‘Falkenlied’ des Kürenbergers
(MF I, 6-7) und Kriemhilds Falkentraum in der 1. Åventiure:
Liebeskonzeption, Männlichkeitsideal, Strophenform – Thema für Referat bzw.
Hausarbeit; b) Gudruns Traum in der ‘Völsungensaga’
und Kriemhilds Traum im NL (Str. 12-18) 4) 22.11.2010 a) die Gestalt Siegfrieds in altnordischer Überlieferung, im
‘Hürnen Seyfried’ und im NL
– Thema für Referat bzw. Hausarbeit; b) Siegfrieds ‘minne’
und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 279-306) – Einfluss des Minnesangs 5) 29.11.2010 a) die Gestalt Brünhilds in
altnordischer Überlieferung und im NL – Thema für Referat bzw. Hausarbeit;
b) Gunthers Brautwerbung (Str. 391-477): Formen symbolischer Kommunikation,
neuartige Erzählregie und die Funktion des Doppelbetrugs im NL 6) 6.12.2010 Brünhild in Worms
und ihre 2. Brautnacht (Str. 664-691): Umfunktionierung
mythischer Heldenepikmotive 7) 13.12.2010 a) Der heldische Affekt des
‘Zorns’ in archaischer Heldenepik und der "nît" in
christlich-mittelalterlicher Sündenlehre – Thema für Referat bzw. Hausarbeit;
b) Streit der Königinnen (Str. 823-838 + 845-853): Worin bestehen "zorn" und "nît" der Königinnen im
NL, und warum führen diese Motive zur Peripetie der Haupthandlung? 8) 20.12.2010 a) Xanten und die Verehrung des Hl. Viktors im Mittelalter –
Thema für Referat bzw. Hausarbeit; b) Ermordung Siegfrieds (Str. 924-925
+ 978-1010) – Realismus und Symbolik der Schauplatzschilderung: Christliche Remythisierung eines Vorzeithelden? 9) 10.01.2011 a) Rache im Alten Testament und in mittelalterlicher
Rechtsgeschichte: Rekonstruktion mittelalterlicher Rechtsnormen– Thema für
Referat bzw. Hausarbeit; b) Kriemhilds Trauer, Etzels Brautwerbung und
Kriemhilds Rache im NL (Str. 1273-1287) – Melker Fragment Str. 1170,4-1172,2 +
1175,1-1176,4 in Hs. B beachten! 10) 17.01.2011 a) Hagen in altnordischer Überlieferung und im NL – Thema
für Referat bzw. Hausarbeit; b) Zug zu den Hunnen, Donauüberquerung
(Str. 1560-1579): Hagen und die Wandlungen seines Persönlichkeitsbildes in den Hss. B und C 11) 24.01.2011 Gastvortrag von Prof. Dr. em. Horst Brunner
über die mhd. Sangversepik und ihre Melodien: 16.15-17.00
Uhr; anschließend Gastkonzert:
Das ‘Nibelungenlied’ in Ausschnitten dargeboten von Dr. Eberhard Kummer
(Bassbariton, Schoßharfe), 17:15-19:00 12) 31.01.2011 a) Kriemhild und die Wandlungen ihres Persönlichkeitsbildes in den Hss. B und C – Thema
für Referat bzw. Hausarbeit; b) Kriemhilds Rache und Tod, Lektüre,
Übersetzung und Interpretation der Str. 2423-2440 mit Bewertung der
unterschiedlichen "nôt"– und "liet"–Fassungen
(B und C) 13) 07.02.2011 a)
Mittelalterliche Rezeptionsgeschichte - Die "Nibelungenklage"
und ihre Bewertung von Geschehen und Handlungsträgern – Thema für Referat
bzw. Hausarbeit (Ausgabe: Mhd. Text mit Übers. und
Kommentar von E. Lienert. Paderborn 2000; b)
Lektüre, Übersetzung und Interpretation der Verse 3393-3484 der ‘Klage’) ANMELDUNGEN
ZU REFERATEN BITTE PER EMAIL AN: Sieglinde.Hartmann@germanistik.uni-wuerzburg.de LITERATUR BITTE AUCH
DIE MATERIALIEN ZUR VORLESUNG VOM SOMMERSEMESTER 2010 UNTEN AUF DIESER SEITE
BEACHTEN! Textgrundlagen: Das Nibelungenlied. Nach der Hs. C der Badischen Landesbibliothek
Karlsruhe. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Hrsg. und übersetzt von Ursula Schulze.
München: dtv 2008, oder Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch
/ Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor. Ins Nhd. übersetzt und kommentiert von Siegfried
Grosse. Stuttgart: Reclam 2002 u. ö. (mit KOMMENTAR, Literaturverzeichnis und
Nachwort!). Musikalische
Neuaufführung des Epos:
Nibelungenlied. Complete Recording by Eberhard Kummer
on two MP3 CDs. The Chaucer Studio. Brigham Young University. USA 2007. Altnordische Nibelungendichtungen: Die Götter- und Heldenlieder der Älteren. Übersetzt.
kommentiert und hrsg. von Arnulf Krause. Stuttgart: Reclam 2004. Nordische Nibelungen. Die Sagas von den Völsungen,
von Ragnar Lodbrok und Hrolf
Kraki. Aus dem Altnordischen übertragen von Paul
Hermann. Hrsg. von Ulf Diederichs. Köln 1985. Die Geschichte Thidreks von Bern
(= Thidrekssaga). Übertragen von Fine Erichsen. Jena
1924. Nachdruck München 1996. Internetausgabe
der Hs. Cmit Abbildungen sämtlicher Seiten, Transkriptionen +
Teilübersetzungen + Links): http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.html Zum Vergleich: Das Nibelungenlied. Nach der St. Galler Handschrift (= Hs. B) hrsg. und erläutert
von Hermann Reichert. Berlin: W. de Gruyter Verlag 2005. Sprachliche Hilfsmittel und Lexika Matthias LEXER: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig 1872-1878. Nachdruck
Stuttgart 1979 (mit Belegstellen). Matthias LEXER: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
Neueste Auflage. Stuttgart: S. Hirzel Verlag. Hermann
PAUL: Mittelhochdeutsche Grammatik. 24. Aufl. Neu bearb. von P. WIEHL und Siegfried GROSSE. Tübingen: M. Niemeyer Verlag 1998. Sekundärliteratur: Winder
McCONNELL (Hrsg.): A Companion
to the Nibelungenlied. Columbia 1998. Die
Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hg. von Joachim Heinzle,
Klaus Klein und Ulrike Obhof. Wiesbaden 2003. Jürgen BREUER (Hrsg.): Ze Lorse bi dem münster. Das Nibelungenlied (Handschrift C).
Literarische Innovation und politische Zeitgeschichte. München: Wilhelm Fink
Verlag 2006. Otfrid EHRISMANN: Nibelungenlied. Epoche - Werk
- Wirkung. 2. Aufl. München 2002. Otfrid EHRISMANN: Das Nibelungenlied. München
2005 (= C.H.BECK WISSEN 2372). Christoph
FASBENDER (Hrsg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2005. Volker GALLÉ
(Hrsg.) Siegfried. Schmied und Drachentöter. Worms 2005 (= Band 1 der
Nibelungenedition). John GREENFIELD (Hrsg.): Das
Nibelungenlied. Actas de
Simpósio Internacional 2000. Porto 2001. Edward
HAYMES: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München 1999 [= UTB
2070]. Joachim
HEINZLE: Das Nibelungenlied. Eine Einführung. Frankfurt a.M.
1994 [=Fischer TB 11843]. Joachim
HEINZLE: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005. Werner
HOFFMANN: Das Nibelungenlied. 5. Aufl. Stuttgart 1982 [= Slg.
Metzler 7]. Victor
MILLET: Germanische Heldendichtung im Mittelalter. Eine Einführung. Berlin
2008. Jan-Dirk
MÜLLER: Das Nibelungenlied. Berlin 2002 [= Klassiker-Lektüren 2] –Neueste,
überarbeitete Auflage! Ursula
SCHULZE: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 [= Reclam Literaturstudium 17604]. Zur Überlieferung: Klaus
Klein: Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften des Nibelungenliedes;
+ Lothar Voetz: Die Nibelungenlied-Handschriften
des 15. und 16. Jahrhunderts im Überblick; + Joachim Heinzle:
Die Handschriften des Nibelungenliedes und die Entwicklung des Textes;
alle 3 Beiträge in: Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Hrsg. von Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ulrike Obhof.
Wiesbaden 2003.
Hauptseminar
in Übungsraum 10, montags 16.00–19.00, Beginn: 25.10.2010
Mittelalterliche Heldenepik:
_________________________________________________________________________________________
Sieglinde Hartmann –
Vorlesung Sommersemester 2010:
Die Wiederkehr der Mythen
I:
Die Nibelungen und das
‚Nibelungenlied’

Erste Seite der ältesten Handschrift C des
‚Nibelungenlieds’; Pergament, ca. 1230; Codex Donaueschingen 63; Badische Landesbibliothek
Karlsruhe
Vollständig digitalisiert aufzurufen unter dem link
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/nib/uebersicht.html
(Mit Einführung und Handschriftenbeschreibung!
Edition dieser Fassung
von:
Ursula Schulze (Hg.), Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch /
Neuhochdeutsch. Hg. und übersetzt von U. S. (dtv 13693), München 2008 (nach
Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 63).
Inhalt und Zielsetzung der
Vorlesung
Am
31. Juli 2009 sind die drei ältesten Handschriften des Nibelungenlieds in das UNESCO Register des
Weltdokumentenerbes aufgenommen worden. Damit zählt das mittelhochdeutsche Epos zu den ersten mittelalterlichen
Dichtungen Europas, welche zum immateriellen Erbe der gesamten
Menschheit gehören. Worin liegt das
Geheimnis dieser außerordentlichen Faszinationskraft begründet? Wie
vergleichbare Heldenepen der Weltliteratur, so hat sich die Wirkung des Nibelungenlieds ebenfalls über
Sprachbarrieren und Epochengrenzen hinaus entfaltet. Dabei zeigt die
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Nibelungenlieds,
dass die Wertschätzung dieses Werks eng mit dem Wiederaufleben von Sagen und
Mythen aus heroischer Vorzeit zusammenhängt. Aus heutiger Sicht gilt das 12.
Jahrhundert als die erste nachantike Epoche, die durch eine Wiederkehr von
Mythen in Literatur und (höfischer) Kultur geprägt ist. In der Vorlesung sollen
daher epochenspezifische Fragen nach dem Wiederaufleben der Nibelungenmythen
erörtert werden: Worin unterscheidet sich die Stoffgestaltung im Nibelungenlied von den altnordischen
Nibelungendichtungen? Wie viel Mythisches bleibt in den Hauptgestalten des mhd.
Epos’ noch wirksam? Welche neue Sinngebung suggeriert die Neuordnung von
Handlung und Figurenkonstellation? Warum haben spätere, mittelalterliche wie
neuzeitliche Bearbeitungen wieder auf die älteren Heldenmuster zurückgegriffen?
Was lernen wir daraus für die weitgehend noch unerforschte periodische
Wiederkehr von Mythen?
Das
sind einige der Fragen, die in der Vorlesung erörtert werden sollen.
Gleichzeitig bietet die Vorlesung einen Überblick über die wesentlichen
Interpretationsprobleme, wie sie die aktuelle mediävistische Forschung zum Nibelungenlied beherrschen. Die
Vorlesung wendet sich an fortgeschrittene Studierende und setzt daher die
Kenntnis des Nibelungenlieds voraus.
Textgrundlagen:
Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor. Ins Nhd. übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. Stuttgart: Reclam 2002 u. ö. (mit Literaturverzeichnis und Nachwort!).
Ursula Schulze (Hg.), Das Nibelungenlied.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Hg. und übersetzt von U. S. (dtv 13693),
München 2008 (nach Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 63).
Musikalische Neuaufführung des Epos: Nibelungenlied. Complete Recording by Eberhard
Kummer on two MP3 CDs. The Chaucer Studio.
Folgende
Sammelbände bieten die neueste Sekundärliteratur:
Ehrismann,
Otfrid: Nibelungenlied. Epoche - Werk - Wirkung. 2. Aufl. München 2002.
Fasbender,
Christoph (Hrsg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2005.
Gentry,
Francis G., McConnell, Winder, Müller, Ulrich and Wunderlich, Werner (Hrsg.): The
Nibelungen Tradition. An Encyclopedia.
John Greenfield (Hrsg.): Das Nibelungenlied. Actas
de Simpósio Internacional 2000. Porto 2001.
Haymes, Edward: Das Nibelungenlied. Geschichte und Interpretation. München 1999 [= UTB 2070].
Heinzle,
Joachim, Klein, Klaus and Obhof, Ulrike (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage – Epos –
Mythos. Wiesbaden 2003.
Heinzle,
Joachim: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005.
Jefferis, Sibylle (Hrsg.): The Nibelungenlied: Genesis, Interpretation, Reception (Kalamazoo
Papers 1997-2005). Göppingen: Kümmerle 2006.
McConnell, Winder (Hrsg.): A Companion to the Nibelungenlied. Columbia 1998.
Müller,
Jan-Dirk: Das Nibelungenlied. Berlin 2002 [= Klassiker-Lektüren 2] – neueste
überarb. Auflage!
Schulze, Ursula: Das Nibelungenlied. Stuttgart 1997 (= Reclam
Literaturstudium 17604).
VORANKÜNDIGUNG FÜR DAS
WINTERSEMESTER:
Sieglinde Hartmann Hauptseminar WS 2010/2011
Mittelalterliche
Heldenepik: Das Nibelungenlied auf Basis der Hs. C
Vorlesungsplan - Mo
15.00-16.30, Hörsaal 2
1) 26. April 2010 –
Einführung: Die Wiederkehr antiker Mythen im 12. Jahrhundert, ihre Quellen,
Stoffkreise und das ‚Nibelungenlied’
2) 3. Mai 2010 – Das
‚Nibelungenlied’ im Kontext archaischer Heldendichtungen, seine Überlieferung
im deutschen Sprachraum und die Verbreitung des Nibelungenstoffs in
altnordischer Literatur
3) 10. Mai 2010 – Neues Heldenideal und neue Strophenform:
Kriemhilds Traum (1. Âventiure nach Hs. C) und das ‚Falkenlied’ des Kürenbergers (MF
I, 6-7)
4) 17. Mai 2010 –
Siegfrieds „minne” und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 280-307- Hs. C) - Einfluss des Minnesangs und
höfische Überformung des Stoffes
5) 31. Mai 2010 – Die
Brautwerbung um Brünhild auf Island (7. Âventiure) -- neuartige
Personencharakterisierung und Kunst dramatischer Handlungsführung
6) 7. Juni 2010 – Brünhilds
2. Brautnacht in Worms: Umfunktionierung mythischer Heldenepikmotive +
symbolische Kommunikation im ‚Nibelungenlied’
7) 14. Juni 2010 – Streit der Königinnen (Str.
834-850) - Peripetie der Haupthandlung?
8) 21. Juni 2010 – Ermordung Siegfrieds (Str. 978-998) –
Christliche Remythisierung der Gestalt Siegfrieds?
9) 28. Juni 2010 – Neue methodische Paradigmen und ihre Funktion
für die Deutung des 2. Teils des ‚Nibelungenlieds’
10) 5. Juli 2010 – Der
Untergang der Nibelungen: die Kontrahenten Hagen und Kriemhild und ihre
Remythisierung im ‚Nibelungenlied’ und bei Richard Wagner
Tischvorlage zur 10. Sitzung: Hagen im Nibelungenlied im Link
Tischvorlage zur 10. Sitzung: Kriemhild im Nibelungenlied im Link
MATERIALIEN ZUR VORLESUNG
Zu 1) 26. April 2010 –
Einführung: Die Wiederkehr antiker Mythen im 12. Jahrhundert, ihre Quellen,
Stoffkreise und das ‚Nibelungenlied’
Die
bedeutendsten Heldenepen der Weltliteratur, ihre mythischen Stoffe, ihre
Verschriftlichung und ihre periodische Wiederkehr
1) Gilgamesh-Epos
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
um 2500 v. Chr.; Titelheros: König Gilgamesh (Lebenszeit: um 2600 oder 2500 v. Chr.) = Begründer der
Stadt Uruq, Hauptstadt des altsumerischen Reiches.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos von
Gilgamesh: circa 1200 v. Christus
in einem Großepos in 12
sogenannten ‚Tafeln’ von rund 3000 Versen; Autor unbekannt = rund 1200
Jahre später.
2) Homers ‚Ilias’ und
‚Odyssee’ (Fall von Troja)
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
13. oder 12. Jahrhundert v. Chr.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos der
‚Ilias’ (= Fall von Troja = Ilion): circa 800 v. Christus in einem Großepos von 24 Büchern mit etwa
15000 Versen (= Hexametern); Autor: Homer, mehr als Name nicht bekannt =
rund 500-600 Jahre später.
c) Wiederkehr der trojanischen Mythen im
12. Jahrhundert (in afz. und mhd. Versionen) sowie nochmals 600-800 Jahre später
in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
3) Die ‚Aeneis’ des Römers Vergil (Gründung Roms)
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
um 800-700 v. Chr.: Gründung Roms: 753
v. Chr. = ab urbe condita der römischen Zeitrechnung.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos der ‚Aeneis’: 29-19 v. Chr. in 12 Gesängen von
9896 Hexametern (unvollendet) = rund 700 Jahre später.
c) Wiederkehr der Mythen von der
Gründung Romas im 12. Jahrhundert (in afz. und mhd. Versionen) sowie nochmals
600-800 Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
4) Das ‚Nibelungenlied’ und die
Dietrichepik des Hochmittelalters
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
Völkerwanderungszeit ca. 400-600 n. Chr.:
Untergang der Burgunden: 437 n.
Chr.; Untergang des Hunnenreichs und Tod Attilas: 453 n. Chr.; Theoderich der
Große (ca. 451-526 = Dietrich von Bern)): Blüte und Ende des Ostgotenreichs in
Italien.
b) Verschriftlichung zum Heldenepos des
’Nibelungenlieds’: um 1200 n. Chr. in
38 bzw, 39 Âventiuren von rund 10000 Langversen = rund 600-700 Jahre später.
c) Wiederkehr der Nibelungen-Mythen
600-700 Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
5) Die mittelalterliche Artusepik
a) Entstehungszeit der Sagen und Mythen:
Völkerwanderungszeit ca. 400-600 n. Chr.:
Zusammenbruch der Römerherrschaft in Britannien; Artus = legendärer
Stammesführer, der das Reich Britannien im 5. oder 6. Jahrhundert
wiederhergestellt habe.
b) Verschriftlichung in höfischen
Romanen mit König Artus und seinen Rittern von der Tafelrunde in afrz. und mhd.
Versionen des 12. und 13. Jahrhunderts =
rund 500-600 Jahre später.
c) Wiederkehr der Artusmythen 600-700
Jahre später in Literatur, Musikdramen und Filmen der Moderne.
Zu 2) 3. Mai 2010 – Das
‚Nibelungenlied’ im Kontext archaischer Heldendichtungen, seine Überlieferung
im deutschen Sprachraum und die Verbreitung des Nibelungenstoffs in
altnordischer Literatur
The Nordic Nibelungen Tradition and its Main Sources
1)
Poetic
2) The Prose Edda of Snorri
Sturluson (1179-1241); Anthony Faulkes (Ed.): Edda by Snorri Sturluson: Prologue and
Gylfaginning (Oxford 1982) and Edda by Snorri Sturluson: Skáldskaparmál,
2 vols. (
3)
The Völsungasaga, Norway ca. 1250; R. G. Finch (ed., transl.) The Saga of the Volsungs. London 1965;
German translation: Nordische Nibelungen.
Die Sagas von den
Völsungen, von Ragnar Lodbrok und Hrolf Kraki. Aus dem Altnordischen übertragen
von Paul Hermann. Hrsg. von Ulf Diederichs. Köln 1985.
4) Thidrekssaga, Norway, ca. 1250; Henrik Bertelsen (ed.): Thidreks Saga af Bern. 2 vols.
Copenhagen 1905-1911; German translation: Die
Geschichte Thidreks von Bern. Übertragen von Fine Erichsen. Jena 1924.
Nachdruck München 1996.
Inhaltsunterschiede zwischen deutschem und
altnordischen Nibelungenstoff
Hauptgestalten: 3 königliche Familien und Brünhild
In der skandinavischen Nibelungentradition werden die
Burgunden stets ‚Niflungen’ genannt = ‚Nibelungen’
|
Das mittelhochdeutsche ‚Nibelungenlied’ 1) Der Burgundenhof in Worms am Oberrhein Königinmutter: Uote, Vater:
Dancrat 3
Söhne: Gunther, Gernot, Giselher + Schwester Kriemhild Höchster Vassal: Hagen
(= Högni), Siegfrieds Mörder 2) Der Königshof der ‚Niederlande’ in Xanten am
Niederrhein Königinmutter: Sieglinde,
Vater: Sigismund 1 Sohn: Siegfried = Kronprinz von Niederland, Herrscher über die
Nibelungen, wirbt um Kriemhild und heiratet sie 3) Der Hunnenhof in Etzelburg a.d. Donau König: Etzel (= Attila),
heiratet Kriemhild in 2. Ehe, um
die êre, das Ansehen seiner Macht zu erhöhen. 4) Brünhild = Unbezwingbare jungfräuliche Königin von Îslant mit Isenstein als Hauptburg; Brautwerber müssen 3 Freierproben bestehen, was nur Sioegfried gelingt (an Gunthers Stelle), daher heiratet Brünhild Gunther |
Die altnordische Tradition 1) Der Hof der Niflungen Königinmutter: Grimhild,
Vater: Gjuki 3 Söhne: Högni, Gunnar,
Guthorm (= Sigurds Mörder) + Schwester
Gudrun 2) Der Hof König
Sigismunds Königin: 2 Namen genannt:
Sisibe, Hjordis; 1 Name nicht erwähnt 1 Sohn: Jung Sigurd, der
Fafnir (= Drachen) Töter, erringt Nibelungenschatz,
liebt Brynhild, aber nach einem Vergessenstrank heiratet er Gudrun 3) Der Hunnenhof (unterschiedliche Orte in Nordwestdeutschland, u.a.
Soest) König: Atli (= Attila)
heiratet in 2. Ehe Gudrun, Sigurds Witwe, um in den Besitz des Niflungenhorts zu gelangen 4) Brynhild = Walküre, Tochter von Odin (höchster Gott in anord. Mythologie), in einigen
Dichtungen ist sie Atlis Schwester, meist mit Sigurd verlobt, aber sie
heiratet Gunnar |
Zu 3) 10. Mai 2010 – Neues Heldenideal und neue Strophenform:
Kriemhilds Traum (1.
Âventiure nach Hs. C) und das ‚Falkenlied’ des Kürenbergers (MF
I, 6-7)
Zu 4) 17. Mai 2010 –
Siegfrieds „minne” und 1. Begegnung mit Kriemhild (Str. 280-307- Hs. C)
- Einfluss des Minnesangs und
höfische Überformung des Stoffes
Zu 5) 31. Mai 2010 – Die Brautwerbung
um Brünhild auf Island (7. Âventiure) -- neuartige Personencharakterisierung
und Kunst dramatischer Handlungsführung
Zu 6) 7. Juni 2010 –
Brünhilds 2. Brautnacht in Worms: Umfunktionierung mythischer Heldenepikmotive
+ symbolische Kommunikation im ‚Nibelungenlied’
Zu 7) 14. Juni 2010 – Streit der Königinnen (Str.
834-850) - Peripetie der Haupthandlung?
Zu 8) 21. Juni 2010 – Ermordung Siegfrieds (Str. 978-998) – Christliche Remythisierung der Gestalt Siegfrieds?
Sieglinde Hartmann SS 2010 VL :
Die Nibelungen und das “Nibelungenlied”
Handlungsstrukturen, Motive und Schauplätze im
Vergleich:
Siegfried/Sigurd (anord.), Brünhild + Kriemhild
(anord: Gudrun)
|
|
Ältere Edda |
Snorris Prosa-Edda |
Völsungensaga |
Thidrekssaga |
Nibelungenlied |
|
Abstammung + Vorgeschichte: |
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin) |
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin) |
Völsungengeschlecht
(Stammvater: Gott Odin) |
Königsgeschlecht von Tarlungaland = in Schwaben? |
Königsgeschlecht von
“Niederland” am Rhein |
|
Eltern: |
Vater: Siegmund, Mutter: namenlos
|
Vater: Siegmund, Mutter:
Hjördis |
Vater: Siegmund, Mutter:
Hjördis |
Vater: Siegmund, Mutter: Prinzessin
Sisibe von Spani- en |
Vater: Siegmund, Mutter: Sieglinde, Residenz: Xanten |
|
Geburt, Jugend + Erziehung |
Als Ziehsohn beim Schmied
Regin, Ort: am Rhein |
Als Ziehsohn des Schmieds
Regin am Hof König Hjalpreks (= Hjördis 2. Gatte) in Dänemark |
Am Hof König Hjalpreks (=
Hjördis 2. Gatte) in Däne- Mark mit Regin als Erzieher |
Die unschuldig verstoßene
Sisibe gebiert Sigurd im Wald, Aussetzung des Kindes im Glasgefäß; Errettung
durch Hindin, Auffinden durch Schmied Mime, Erziehung zum Schmied |
Königlich ritterliche
Erziehung am Xantener Hof |
|
1. Heldentat = Drachentöter |
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Gnitaheide |
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Gnitaheide |
Tötung des Drachens Fafnir
(=Regins Bruder) auf Heide |
Tötung des Drachens (=
Mimes Bruder) im Wald |
Nur indirekt in Hagens
Bericht er- wähnt |
|
2. Wunder = Drachenblut |
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung |
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung |
Berührung mit Drachenblut
beim Braten seines Herzens = Verständnis der Vogelsprache + Vogelweissagung |
Berührung mit Brühe aus Drachenfleisch
= Verständnis der Vogelsprache +
Vogelweissagung + Erlangung einer Hornhaut durch Bestreichen mit Drachenblut |
Nur indirekt in Hagens
Bericht er- wähnt : Erlangung einer Hornhaut
durch Bad im Drachen- Blut; verwundbare Stelle
durch Lindenblatt zwischen Schulterblättern |
|
3. Heldentat = Erbeutung des
Nibelungen- horts |
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts |
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts |
Nach Ermordung Regins,
Erbeutung des Horts |
NICHT DARGESTELLT |
Nur indirekt in Hagens
Bericht er- wähnt : Erbeutung des
Nibelungenhorts durch Töten der Brüder Niflung + Schilbung |
|
4. Heldentat = Erlösung Brünhilds
(= Walküre, von Odin zur Strafe für Ungehor- sam in Schlaf auf Berg/Burg
gebannt) |
S. überwindet Schildwall auf
Berg Hindarfjall u. zerschneidet die Brünne der Sigrdrifa (= Name für
Brünhild) + Variante im “Jüngeren Sigurdlied”: Brünhild = Schildmaid +
Schwester des Hunnenkönigs Atli |
S. reitet zum Haus auf Berg
u. erweckt die Walküre Brünhild durch Zerschneiden der Brünne |
S. reitet zum Berg
Hindarfjall, südwärts im Frankenland, u. erweckt die Schildjungfrau +
Königstochter Brünhild durch Zerschneiden der Brünne, sie schwören sich ewige
Liebe + nach weiteren Abenteuern 2. Wiedersehen mit Br. + 2.
Liebesschwur + Weissagung der Ehe mit Gudrun |
S. reitet zu Brünhilds Burg,
um Hengst Grane aus ihrem Gestüt zu holen (Später heißt es, Sigurd +
Brünhild hätten sich bereits bei ihrem 1. Treffen eidlich verbunden) |
Nicht dargestellt, aber
frühere Begegnung mit Brünhild stillschweigend vorausgesetzt |
|
5. Station: Hof der
Burgunden, Namen der Königsfamilie |
Burgunden = Niflungen,
Vater: Gjuki,Mutter: Grimhild; Söhne:
Gunnar, Högni, Gotthorm, Schwester: Gudrun |
Niflungen, Vater:
Gjuki, Mutter: Grimhild; Kinder:
Gunnar, Högni, Gudrun, Gudny; Gotthorm = Gjukis Stiefsohn |
Niflungenhof, südlich am
Rhein, Vater: Gjuki,Mutter: Grimhild;
Kinder: Gunnar, Högni, Gutthorm, Gudrun |
Mit König Thidrek ins
Niflungenland, König: Gunnar, Brüder:
Högni + Gernoz, Schwester: Grimhild; Resi- denzstadt: Werniza |
Burgunden in Worms am Rhein,
Vater: Dankrat, Mutter: Uta; Kinder:
Gun- ther, Gernot, Gisel- her, Kriemhild |
|
6. Wunder: Vergessens- trank |
|
|
Königinmutter Grimhild
löscht Erinnerung an Brünhild aus |
|
|
|
7. Liebe zur burgundischen Prinzessin |
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau |
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau |
Sigurd erhält Gudrun zur
Frau aufgrund des Vergessenstranks |
Sigurd erhält Grimhild zur
Frau |
Fernliebe zu Kriemhild von
Anbeginn aufgrund ihres höf. Wesens, ihrer Schönheit + Tugend |
|
8. Verhältnis zu König
Gunther |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
“triuwe” - kein Eid |
|
9. Verhältnis zu Hagen |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
Blutsbrüderschaft durch
Treueschwur |
|
|
|
10. Brautwerbung um
Brünhild für Gunther, Erfolg durch Siegfrieds Täu- schungsma- növer |
Sigurd überwindet
Schildwall, erlöst Brünhild, vollzieht aber nicht das Beilager |
Täuschungsmanöver:
Gestaltentausch; Sigurd reitet für Gunnar durch Waberlohe, vollzieht nicht
das Beilager, aber tauscht mit Brynhild Ringe (Andwaris Ring aus
Nibelungenhort = Morgengabe für B.) |
Täuschungsmanöver:
Gestaltentausch; Sigurd reitet für Gunnar durch Waberlohe, vollzieht nicht
das Beilager, aber tauscht mit Brynhild Ringe (Sigurd nimmt B. den Ring
Andwaris + gibt ihr einen anderen Ring
aus Nibelungenhort) |
Brautwerbung um B. (=
Königin der Stadt Seegard in Schwaben) für Günther durch Gespräch und
Beratung mit den Königen Thidrek + Gunnar; Brünhild willigt schließlich ein |
Brautwerbung um Königin
Brünhild für Gunther, Siegfried täuscht B. mit Standeslüge + bezwingt sie im
Wettkampf mithilfe des Tarnmantels |
|
11. Ehe von Kriemhild und
Siegfried |
glücklich |
2 Kinder: Sigmund +
Svanhild |
1 Kind: Svanhild |
|
Glücklich: 1 Sohn: Gunther |
|
12. Ehevollzug von Brünhild
und Gunther nach Siegfrieds 2. Täuschungs- manöver |
Brünhilds Ehe = “Unheil”,
von Nornen vorherbestimmt |
|
Nach Brünhilds + Gunnars
Hochzeit erinnert sich Sigurd an seine Liebesschwüre |
Sigurd bezwingt Brünhild in
der 2. Brautnacht mithilfe eines Kleidertauschs, entjungfert sie + Ringtausch |
Siegfried bezwingt Brünhild
in der 2. Brautnacht mithilfe der Tarnkappe, entwendet ihr Ring + Gürtel, entjung- fert sie jedoch nicht |
|
13. Brünhilds “nít” |
Brünhild neidet Gudrun den
Gatten, weil sie nur ihn liebt |
NICHT DARGESTELLT |
NICHT DARGESTELLT |
NICHT DARGESTELLT |
Brünhild unglücklich aus Neid
auf Kriemhild + aus Verdacht, betrogen worden zu sein; daher hinterlistige
Einla- dung nach Worms |
|
14. Zerwürfnis der
Königinnen |
|
Beim Haarewaschen im Fluss
provoziert Brynhild Gudrun: Gunnar sei der kühnere Held, weil er die
Waberlohe durchritten habe; Gudruns Antwort: Vorzeigen des Rings Andvaranaut
als Beweis für Sigurd als B.”s Bezwinger |
Beim Baden im Fluss
provoziert Brynhild Gudrun: Gunnar sei der kühnere Held, weil er die
Waberlohe durchritten; Gudruns Antwort: Vorzeigen des Rings als Beweis für
Sigurd als B.”s Bezwinger; B. entdeckt den Betrug an ihr + an Sigurd |
Brünhild provoziert Grimhild
zum Rangstreit in der Königshalle, Grimhilds Antwort: Vorzeigen des Rings als
Beweis dafür, dass Sigurd B.”s
bezwungen + entjungfert hat |
Brünhild provoziert Kriemhild
zum Rangstreit auf der Treppe zum Wormser Münster; Kriemhilds Ant- wort: Siegfried sei ihr
Bezwinger gewesen, Vorzei- gen von Ring + Gürtel als
Beweise dafür, dass Siegfried B.
entjungfert hat |
|
15.Brünhild = Anstifterin
zum Mord an Siegfried |
Da sie Sigurd nicht haben
kann, muss er sterben |
Betrug an Brynhild = Motiv
für S.”s Ermordung |
Betrug an B. = Motiv für
S.”s Ermordung |
Rache für öffentliche
Entehrung = Motiv für S.”s Ermordung |
Rache für öffent- liche Entehrung = Motiv für
S.”s Ermordung |
|
16. Ermordung des unbewaff- neten Sieg- frieds a) Mörder |
Ältere Edda Anstifterin : Brünhild, ausführender
Mörder: Gotthorm; Eidbrüchig:
Gunnar; Högni widerrät, aber
widersetzt sich nicht; daher alle 3 = Mörder |
Prosa-Edda Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Gotthorm;
Eidbrüchig: Gunnar + Högni = 3 Mörder |
Völsungensaga Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Gotthorm;
Eidbrüchig: Gunnar; Högni widerrät,
aber widersetzt sich nicht; daher alle 3 = Mörder |
Thidrekssaga Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Högni mit Gunnars
Einverständnis |
Nibelungenlied Anstifterin : Brünhild,
Ausführender Mörder: Hagen mit
Gunthers Billigung |
|
17. Siegfrieds Ermordung b) Schauplatz |
“südlich am Rhein” im Wald
oder im Bett, Ed. A. Krause, S.354 + 357 |
Im Schlaf im Bett |
Im Schlaf im Bett |
Im Wald auf der Jagd bei
einer Rast ersticht Högni den trinkenden Sigurd von hinten zwischen den
Schulterblättern mit Sigurds Speer |
Auf der Jagd auf einer
bewaldeten Rheininsel vor dem Odenwald; bei der Rast ersticht Hagen den trinkenden Siegfried von hinten
zwischen den Schulterblät- tern mit dessen Speer |
|
18. Brünhilds Ende |
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche + “Helfahrt” |
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche |
Freitod + Verbrennen mit
Sigurds Leiche |
|
Nicht dargestellt |
|
19. Kriemhilds Rache + Ende |
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Ende: Tod aller aus Rache für den Mord an ihren Brüdern |
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Ende: Tod aller aus Rache für den Mord an ihren Brüdern |
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), Atli lädt Högni + Gunnar ein, aus Gier nach dem Hort + um
seine Schwester (= Brynhild) zu
rächen; Ende: Tod aller Hunnen, Gudrun überlebt + verheiratet sich zum 3. Mal
(mit König Jonakr) |
Gudrun vermählt sich zum 2.
Mal (mit Atli), sie lädt Högni + Gunnar ein, um Sigurds Ermordung zu rächen; Ende: Tod aller Hunnen +
Niflungen, Gudrun wird von Thidrek erschlagen |
Kriemhild vermählt sich zum
2. Mal (mit Etzel), sie lädt ihre 3 Brüder + Hagen ein, um Siegfrieds Ermor- dung zu rächen; Ende: Tod vieler Hunnen + aller Nibelungen,
Kriemhild wird von Hildebrand in Stücke gehauen |
|
|
Ältere Edda |
Prosa-Edda |
Völsungensaga |
Thidrekssaga |
Nibelungenlied |
Zu 9) 28. Juni 2010 – Neue methodische Paradigmen und ihre Funktion für die Deutung des 2. Teils des ‚Nibelungenlieds’
Zu 10) 5. Juli 2010 – Der
Untergang der Nibelungen: die Kontrahenten Hagen und Kriemhild und ihre
Remythisierung im ‚Nibelungenlied’ und bei Richard Wagner